Innerhalb eines Tages sammelte eine orthodoxe Haredi-Gemeinde in Williamsburg, Brooklyn, 80.000 US-Dollar, um afghanische Fußballspielerinnen aus Kabul auszufliegen.
Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 stand die afghanische Fußballnationalmannschaft der Frauen allein durch ihre Existenz in Gegnerschaft zu den Taliban.
Diese hatten nach ihrer Machtübernahme 1996 bis zu ihrem Sturz im Jahr 2001 ein Schreckensregime etabliert, in dem es den Frauen verboten war, das Haus ohne männliche Begleitung zu verlassen. Auch dann hatten sie eine Burka zu tragen, ein sackartiges Kleidungsstück, das den ganzen Körper bedeckt und selbst die Augen durch ein Netz verhüllt.
Khalida Popal, die die afghanische Fußballnationalmannschaft gründete, lange Zeit Spielführerin und später sportliche Leiterin war, lebt aufgrund von Morddrohungen gegen sie seit 2016 in Dänemark. Ihr erstes Länderspiel bestritten die afghanischen Fußballerinnen bei der Südasienmeisterschaft 2010 gegen Nepal. Es ging 0:13 aus. Der größte sportliche Erfolg war ein 4:0 gegen Pakistan bei der Südasienmeisterschaft 2012.
Letzte Woche gelang dem Team die Flucht aus Afghanistan, das nun erneut von den Taliban beherrscht wird.
Wie die amerikanische Sportjournalistin Liz Clarke in einem Beitrag für die Washington Post schreibt, landete ein Passagierflugzeug mit mehr als 75 afghanischen Fußballerinnen, Verwandten und Verbandsfunktionären an Bord am Dienstag letzter Woche in Australien. Australien sei das erste Land gewesen, das auf die Bitte eines multinationalen Netzwerks von Sportlern und Menschenrechtsanwälten reagiert und sich als Zufluchtsstätte angeboten hatte, so Clarke.
Ihre Informationen hat die Journalistin von Haley Carter, einer ehemaligen Offizierin des US Marine Corps und früheren Co-Trainerin der afghanischen Frauennationalmannschaft. Carter spielte laut dem Bericht auch eine „Schlüsselrolle“ bei der Koordination der Ausreisebemühungen, gemeinsam mit der Fußballergewerkschaft FIFPro und anderen Fürsprechern, die sich bei Regierungen dafür eingesetzt hätten, dass die Spielerinnen außerhalb Afghanistans Asyl bekommen.
Die politischen und logistischen Hürden bei der Ausreise seien riesig gewesen, berichtete Carter. Sie sprach von einem „digitalen Dünkirchen“, in Anspielung auf eine der größten Evakuierungsaktionen der Geschichte: den fluchtartigen Rückzug über den Ärmelkanal von 370.000 britischen und französischen Soldaten aus der von der deutschen Wehrmacht umzingelten nordfranzösischen Hafenstadt Dünkirchen im Mai und Juni 1940.
Bei ihrer Flucht aus Afghanistan hätten sich viele der Athletinnen und ihre Familien vor Gewehrfeuer in Deckung bringen müssen und seien an Checkpoints der Taliban geschlagen worden, so Carter. Es sei „nicht weniger als ein Wunder“, dass die Flucht geglückt sei. Sie pries die „kanadischen, britischen, schwedischen und australischen Soldaten“, die dabei geholfen hätten, die Spielerinnen zum Flughafen zu bringen, wozu auch gehört habe, ihnen dabei zu helfen, „aus einem Abwasserkanal“ herauszuklettern, der Teil der Fluchtroute gewesen sei.
„Der Feind ist gleich hinter dem Fenster“
Khalida Popal hatte, nachdem die Taliban die Macht in Kabul übernommen hatten, alle Spielerinnen gewarnt, sie müssten sofort sämtliche Profile in den sozialen Medien löschen, ihre Trikots verbrennen und dürften nicht mehr ohne männliche Begleitung das Haus verlassen.
Dass sie solch eine Warnung aussprechen müsse, sei „sehr schmerzhaft“, sagte sie. „Denn all die Jahre lang habe ich dafür gekämpft, die Frauen und Mädchen stark zu machen, das Recht zu erkämpfen, die Trikots zu tragen. Nun sage ich: ‚Zieht sie aus. Verbrennt sie.’“ Der „Feind“ sei gleich „hinter dem Fenster“. Nach der geglückten Flucht teilte FIFPro auf seiner Website mit:
„Es bleibt noch viel zu tun, um diese jungen Frauen zu unterstützen und ihnen ein Zuhause zu geben. Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, dafür zu sorgen, dass sie alle Hilfe erhalten, die sie brauchen. Auch in Afghanistan sind viele Sportler noch immer gefährdet und es sollte alles unternommen werden, um sie zu unterstützen.“
Khalida Popal wird in der Presseerklärung mit den Worten zitiert:
„Die letzten Tage waren extrem stressig, aber heute haben wir einen wichtigen Sieg errungen. Die Fußballerinnen waren in Krisenzeiten mutig und stark und wir hoffen, dass sie außerhalb Afghanistans ein besseres Leben haben werden. Aber es gibt noch viel zu tun. Der Frauenfußball ist eine Familie und wir müssen dafür sorgen, dass alle sicher sind.”
Ultraorthodoxe New Yorker Juden halfen mit
Hier könnte dieser Artikel enden. Die Geschichte ist interessant und aufregend genug. Doch nicht weniger spannend ist, wie laut einem Bericht der jüdischen Nachrichtenagentur JTA chassidische Juden – eine Strömung innerhalb der Ultraorthodoxen – aus Williamsburg, New York City, bei der Flucht der afghanischen Fußballerinnen mithalfen.
Williamsburg ist ein für seine große chassidische Gemeinde bekannter Stadtteil im Stadtbezirk Brooklyn. Laut dem JTA-Bericht hatte der Gründer und Präsident der Bürgerrechtsorganisation Tzedek Association Moshe Margaretten, der der chassidischen Gemeinde Williamsburgs angehört, einen israelisch-amerikanischen Geschäftsmann namens Moti Kahana dafür bezahlt, den letzten in Afghanistan verbliebenen Juden aus dem Land zu holen, einen gewissen Zebulon Simantov.
Kahana habe ein spezielles Team für derartige Aufgaben, das schon während des syrischen Bürgerkriegs Menschen aus Syrien außer Landes gebracht habe, so der Bericht. Als das Team aber bei Simantov eintraf, weigerte sich dieser, Afghanistan zu verlassen. Darauf teilte Kahana Margaretten mit, dass seine Leute in Afghanistan herausgefunden hätten, dass es viele Frauen gebe, die verzweifelt versuchten, das Land zu verlassen. Margaretten gegenüber JTA:
„Moti sagte zu mir: ‚Meine Leute vor Ort sagen mir, dass es eine Gruppe von Fußballerinnen gibt, die große Angst um ihr Leben haben. Sie glauben, dass sie ein wichtiges Ziel für die Taliban werden, die sie töten werden. Vielleicht willst du dich daran beteiligen, ihr Leben zu retten.“
Margaretten habe geantwortet: „Absolut. Gib mir zehn Stunden.“ „Innerhalb eines Tages“, so der JTA-Bericht, „hatte Margaretten aus Williamsburg, Brooklyn, 80.000 US-Dollar von seiner orthodoxen Haredi-Gemeinde gesammelt. Er überwies das Geld an Kahanas Beratungsunternehmen GDC, und bis Mittwoch koordinierte Kahana von seiner Farm in New Jersey die Ausreise von mindestens vier Fußballspielerinnen, einer Richterin, einer Staatsanwältin und ihren Familien, über Land und auf dem Luftweg.“
Kahana sagte, es seien 23 Personen gewesen. Dann, bis Freitag, noch einmal 23. Der nicht verbrauchte Teil des Geldes soll den vor den Taliban Geflohenen helfen, sich ein neues Leben aufzubauen.
Wie JTA weiter berichtet, wollen Margaretten und Kahana weitere Afghanen außer Landes bringen. Dazu wolle Margaretten zwei Millionen US-Dollar an Spenden sammeln. Der Bericht ist von Freitag; es ist unklar, ob sich an diesem Plan durch die am Donnerstagabend verübten Anschläge am Flughafen von Kabul etwas geändert hat.
„Wir können nicht tatenlos zuschauen“
Khalida Popal dankte Margaretten auf Twitter für dessen „unglaubliche Hilfe mit dieser lebensrettenden Rettungsmission, darunter die Koordination zum Flughafen und andere Routen, und politische Verbindungen. Zusammen retten wir Leben!“
Margaretten antwortete ebenfalls auf Twitter: „Danke, Khalida! Es ist uns eine Ehre.“ Etliche Tage vor der Rettungsaktion, am 20. August, hatte Margaretten auf Twitter geäußert, wie sehr ihn die Situation in Afghanistan persönlich berühre. Einen Bericht über das Chaos und die Angst der – meist vergeblich – am Flughafen Kabul auf ihre Ausreise wartenden Afghanen kommentierte er mit den Worten:
„Beängstigend!! Das erinnert mich an das, was meine Großeltern während des Holocaust durchgemacht haben. Wir können nicht tatenlos zuschauen. Wir müssen alles uns Mögliche tun, um zu helfen. Wir sind Amerikaner.“
In Williamsburg gibt es eine der größten ultraorthodoxen Gemeinden außerhalb Israels. Sie geht auf die Einwanderung von chassidischen Juden aus Ungarn und Rumänien nach 1945 zurück – jener von ihnen, die die deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager überlebt hatten, in denen ein großer Teil ihrer Familien ermordet wurde.
Noch heute sind ultraorthodoxe Juden, die aufgrund ihrer Kleidung von weitem als solche zu erkennen sind, besonders stark im Visier von Antisemiten. Auch in Williamsburg und anderen Stadtteilen Brooklyns, wo viele von ihnen leben – wie Crown Heights und Borough Park – werden sie auf der Straße beschimpft und tätlich angegangen, zusammengeschlagen oder gar absichtlich mit dem Auto angefahren (siehe etwa hier, hier, hier und hier).
Um die antisemitischen Angriffe zu stoppen, ließ New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio im Januar 2020 in jenen Wohngegenden einhundert Überwachungskameras installieren.
Der deutsche Publizist Jakob Augstein, Spiegel-Kolumnist und Herausgeber der linksgerichteten Wochenzeitung Freitag, machte 2012 durch eine besonders ignorante, gehässige und antisemitische Äußerung über ultraorthodoxe Juden auf sich aufmerksam, als er schrieb:
„Die Juden haben ihre eigenen Fundamentalisten. Sie heißen nur anders: Ultraorthodoxe oder Haredim. … Diese Leute sind aus dem gleichen Holz geschnitzt wie ihre islamistischen Gegner. Sie folgen dem Gesetz der Rache.“
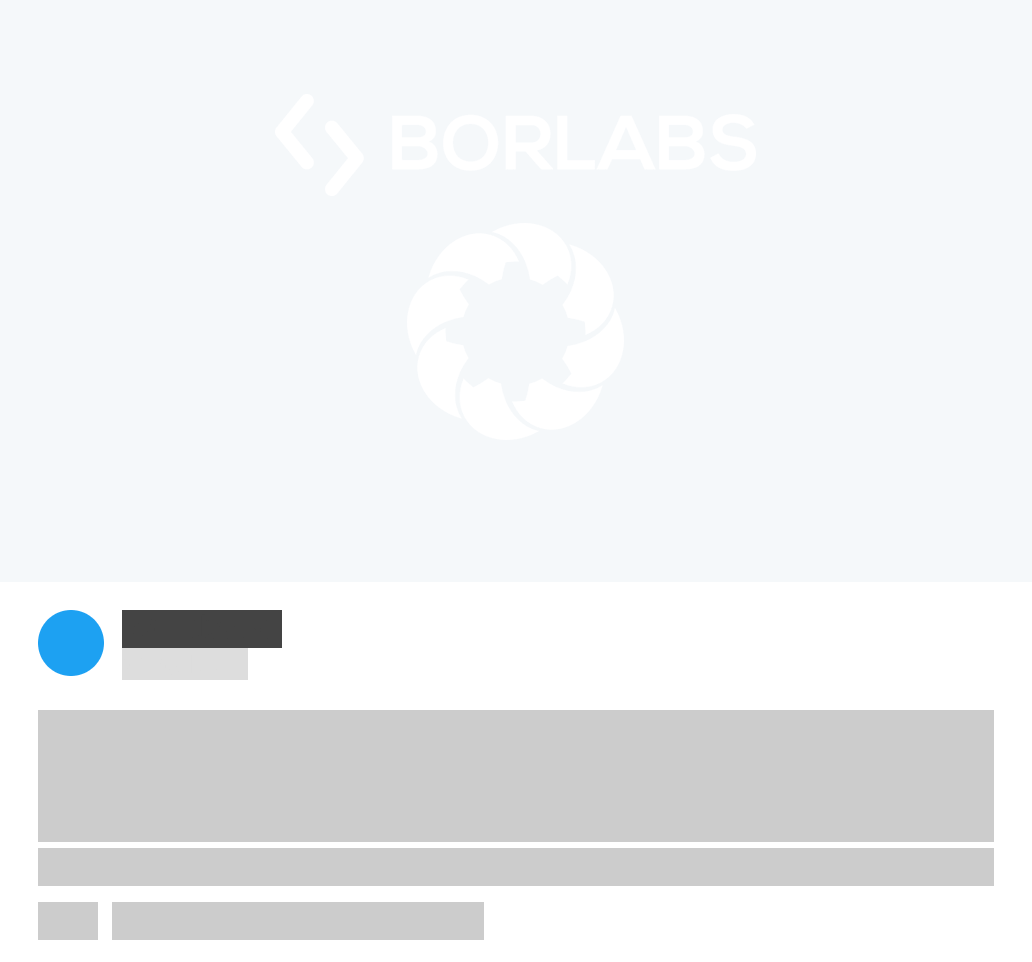
Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.
Mehr erfahren







