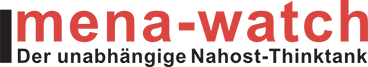Von Florian Markl

Wer war’s?
Bereits kurz nach den Angriffen auf die beiden Tanker im Golf von Oman am 13. Juni veröffentliche das US-Militär eine Videoaufnahme, auf der zu sehen sein soll, wie Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde von einem ihrer Schnellboote aus einen Gegenstand vom Rumpf der Kokuka Courageous entfernen. Dabei soll es sich um eine Haftmine gehandelt haben, die nicht explodiert war und nun beseitigt wurde, um Spuren zu verwischen. Am Montag legte das Verteidigungsministerium eine Reihe weiterer Fotos vor, die diese Vorwürfe weiter untermauern.

Soviel lässt sich jedenfalls sagen:
- Das iranische Regime hat immer wieder damit gedroht, die Straße von Hormus zu blockieren und damit einen beträchtlichen Teil des internationalen Ölhandels lahmzulegen, sollte es dem Land nicht mehr möglich sein, selbst Öl zu exportieren. Es besteht keinerlei Zweifel daran, dass der Iran diese Drohung in der Vergangenheit bereits umgesetzt hat – erinnert sei an die Attacken auf vor allem saudische und kuwaitische Schiffe während des Iran-Irak-Kriegs in den 1980er Jahren.
- Der iranische Ölhandel hat aktuell schwer unter dem steigenden amerikanischen Druck zu leiden. Wenn es sich bei den iranischen Drohungen nicht um bloßes Maulheldentum gehandelt haben soll, wann wenn nicht jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, um sie erneut in die Tat umzusetzen?
- Am 12. Mai ereigneten sich vor der Küste des Emirats Fujairah Angriffe mit Haftminen auf ein emiratisches und ein norwegisches Schiff sowie auf zwei Schiffe unter saudischer Flagge. Eine internationale Untersuchung kam zu dem Schluss: „Auf Basis der Auswertung von Radardaten und der kurzen Zeit, in der die angegriffenen Schiffe vor den Attacken vor Anker gelegen hatten, ist es am wahrscheinlichsten, dass die Minen von Tauchern, die von Schnellboten kamen, an den Schiffen platziert wurden“.
- Die Attacken hätten geheimdienstliche Fähigkeiten erfordert, die angegriffenen Schiffe wurden im Vorhinein sorgfältig ausgewählt, die Attacken erforderten ein hohes Maß an Koordination und ausgezeichnete Fähigkeiten in der Navigation mit Schnellbooten. Der Iran wurde zwar nicht namentlich erwähnt, aber es gibt kaum Zweifel, auf wen sich die folgende Schlussfolgerung bezog: „Diese Fakten deuten stark darauf hin, dass die vier Angriffe teil einer ausgeklügelten und koordinierten Operation waren, die von einem Akteur mit beträchtlichen operationellen Fähigkeiten ausgeführt wurde, aller Wahrscheinlichkeit nach von einem staatlichen Akteur“.
- Am Rumpf der Kokuka Courageous befand sich ein Gegenstand, der von Revolutionsgardisten entfernt wurde, nachdem eine Explosion in ähnlicher Position am hinteren Teil des Schiffes bereits ein Loch in den Rumpf gesprengt hatte.
In der New York Times fasste Bret Stephens zusammen, was sich aus diesen Fakten ergibt:
„Trump mag ein Lügner sein, aber das US-Militär ist keiner. Noch gibt es offene Fragen (…) und es sollte Zeit für eine gründliche Untersuchung eingeräumt werden. Aber es bedarf einer großen Dosis an Selbsttäuschung (oder an Verschwörungstheorien), um so zu tun, als sei der Iran nicht der wahrscheinliche Schuldige und als stellten seine Aktionen keine große Eskalation in der Region dar.“
„Hohe Evidenz“ – aber nicht für viele Medien
An der angesprochenen Selbsttäuschung mangelt es freilich nicht: Etliche Politiker und Journalisten stellen sich dumm und glauben den Amerikanern kein Wort – auch wenn erstaunlicherweise kaum einer von ihnen für die Vorgänge, Videos und Bilder glaubwürdige Erklärungen von der iranischen Seite einfordert, die über die üblichen von Teheran verbreiteten Verschwörungstheorien hinausgingen. „Bislang sind die europäischen Verbündeten von der Schuldzuweisung der USA nicht überzeugt“, schreibt etwa Karl Doemens in den Salzburger Nachrichten. Damit er das behaupten kann, muss er freilich großzügig über bestimmte Fakten hinwegsehen. Er darf beispielsweise nicht erwähnen, dass der europäische Verbündete Großbritannien sich bereits sehr schnell der amerikanischen Einschätzung in Bezug auf die Rolle Teherans angeschlossen hat. Und er darf nicht darauf hinweisen, dass auch Kanzlerin Merkel jüngst von „hohen Evidenzen“ für eine iranische Urheberschaft der Angriffe sprach.
Gerade der Umgang mit dem Statement Merkels ist äußerst instruktiv: Leser der Deutschen Welle erfahren über die Aussage nur aus dem englischsprachigen Teil der Webseite: Auf dessen Startseite rangiert der entsprechende Bericht auf Platz 1 unter der Rubrik „Most Read“ und an vorderster Stelle in der Abteilung „Middle East“. Auf den deutschsprachigen Seiten der Deutschen Welle findet sich der Artikel weder unter der Rubrik „Meistgelesen“, noch in der Abteilung Naher Osten – wie es scheint, existiert er schlicht nicht. Und die Presse berichtete zwar über die Pressekonferenz, auf der Merkel vor einer Verschärfung der Lage in der Region warnte, erwähnte aber mit keinem Wort, dass die Kanzlerin von einer „hohen Evidenz“ der Vorwürfe gegen den Iran sprach. Die anderen von Mena Watch ausgewerteten österreichischen Medien hüllten sich bislang gleichfalls in Schweigen.
Maximaler Druck gescheitert?
So wenig man an eine iranische Schuld für die Tanker-Attacken glauben will, so sicher ist man sich dagegen, dass die Politik des „maximalen Drucks“ der Amerikaner gescheitert sei. Niemals, so der Tenor, werde der Iran bereit sein, dem Druck durch die Trump-Regierung nachzugeben.
Insofern Geschichte als Ratgeber dienen kann, legt diese allerdings den genau entgegengesetzten Schluss nahe: Seit der islamischen Revolution von 1979 hat sich das iranische Regime stets nur dann bewegt, wenn es einfach nicht mehr anders konnte. Während des Iran-Irak-Kriegs schlug es jahrelang irakische Forderungen nach einem Waffenstillstand und einer Beendigung des Krieges aus. Erst als infolge des sogenannten Tanker-Krieges eine größere direkte militärische Auseinandersetzung mit den USA drohte, die das Mullah-Regime nicht überlebt hätte, erklärte sich Khomeini bereit, den ‚Giftbecher‘ des Friedens zu trinken. Im Atomstreit haben die jahrelangen Verhandlungen, die maßgeblich von den Europäern geführt wurden, zu nichts anderem geführt, als dem Iran die nötige Zeit für den Ausbau seines Atomprogramms zu schaffen. Erst einigermaßen strenge internationale Sanktionen, die das Regime an den Rand des wirtschaftlichen Kollapses brachten, zwangen es schließlich dazu, ein Abkommen auszuhandeln.

Kein Plan außer Appeasement
Nun mag stimmen, dass Trump keinen genauen Plan hat, wie es im Konflikt mit dem Iran weitergehen soll. Das europäische Bejammern dieses Umstands ist aber nicht nur einigermaßen geheuchelt, sondern verdeckt vor allem die simple Tatsache, dass die Europäer selbst ebenfalls keinen solchen Plan haben. Sie wollen sich den amerikanischen Schuldzuschreibungen bezüglich der Tanker-Attacken nicht anschließen, können selbst aber nicht einmal ansatzweise sagen, wie sie denn auf die eklatanten Verstöße gegen die internationale Ordnung reagieren wollen, zu deren Erhalt sie sich in Opposition zu Trump so vollmundig bekennen. „In internationalen Gewässern auf unbewaffnete Schiffe zu feuern ist ein direkter Angriff auf die regelbasierte internationale Ordnung“, schreibt Bret Stephens. „Das ungeahndet zuzulassen, kann keine Option sein.“ Bislang war von den Europäern aber noch nicht der leiseste Hinweis darauf zu hören, wie sie denn auf diesen Angriff zu reagieren und grundlegende internationale Normen wie die Freiheit der Schifffahrt zu erhalten gedenken.
Immer lauter werden Stimmen, die von Europa fordern, als Vermittler im Konflikt zwischen dem Iran und den USA aufzutreten. Gerade angesichts der sich zuspitzenden Krise, so die nicht untypische Selbstüberschätzung, sei die Stunde der europäischen Diplomatie gekommen.
Übersehen wird dabei nur, dass die Europäer nichts anzubieten haben. Seit sie sich fast ohne Wenn und Aber zum Erhalt des Atomabkommens verpflichtet haben – und vermutlich noch weiter daran festhalten werden, wenn der Iran es längst gebrochen hat –, bleibt ihnen kaum mehr etwas anderes übrig, als sich vom iranischen Regime an der Nase herumführen zu lassen. Jetzt rächt sich die zentrale Schwäche des Atomdeals: Indem die Infrastruktur des Atomprogramms im Wesentlichen unangetastet geblieben ist und die von ihm ausgehende Gefahr praktisch institutionalisiert statt beseitigt wurde, haben sich die Europäer erpressbar gemacht. Das iranische Regime kann jederzeit mit der Wiederaufnahme von vorübergehend stillgestellten Teilen seines Atomprogramms drohen. Und solange die Europäer sich nicht aus der zum Großteil selbst verschuldeten Zwickmühle befreien, haben sie kaum eine andere Wahl, als das bereits bisher erfolglose Appeasement gegenüber der islamistischen Diktatur noch weiter zu verstärken. Im Interesse eines zahnlosen Abkommens, das die iranische Bombe im besten Fall ein paar Jahre hinauszögert, haben sie den iranischen Hegemonialbestrebungen im Nahen Osten nichts entgegenzusetzen. Dieses Desaster betrachten viele von ihnen als den größten diplomatischen Erfolg der europäischen Außenpolitik – und machen sich damit nicht zuletzt aus Sicht des iranischen Regimes nachhaltig lächerlich, das genau weiß, was es an Heiko Maas, Federica Mogherini und Konsorten hat.