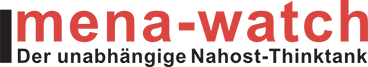In den 1980er-Jahren wurden in den Gefängnissen der Islamischen Republik Iran zahlreiche junge Frauen, allesamt politische Gefangene, vor ihrer Exekution vergewaltigt. Die Vergewaltigungen hatten einen theologischen Hintergrund. Nach islamischer Überlieferung gelangen Jungfrauen, die sterben, ins Paradies. Die Vergewaltigungen sollten dies verhindern. Um die Vergewaltigungen ihrerseits islamrechtlich zu legitimieren, zwang man die Frauen, knapp vor ihrer Exekution, mit einem ihrer Wächter eine sogenannte Zeitehe einzugehen. In einigen Fällen erhielten die Eltern der Exekutierten das Brautgeld. Die Legitimierung der Vergewaltigungen via Zwangsverehelichung wäre aber vielleicht gar nicht notwendig gewesen. Wie Ezzat Mossallanejad meint, sehe der Koran zwar Strafen für außerehelichen Geschlechtsverkehr vor, nicht jedoch (oder zumindest nicht explizit) für Vergewaltigung. Zugleich gestatte er die sexuelle Versklavung ungläubiger weiblicher Kriegsgefangener. In der Islamischen Republik Iran werden (bestimmte) politische Gefangene als Menschen betrachtet, ‚die Krieg gegen Gott führen‘. Dieser Logik folgend, könnten, so Mossalanejad, weibliche politische Gefangene als Kriegsbeute angesehen werden, deren Versklavung – und ergo Vergewaltigung – im Sinne des Korans legitim wäre.
Wie auch immer. Was uns an diesen düsteren Aspekten der islamischen Revolution interessieren sollte, ist, dass sie das gängige Argument, die ‚Islamisten‘ im Iran und anderswo würden den Islam bloß benützen, in Wahrheit ginge es nicht um den Islam, sondern um andere (zum Beispiel machtpolitische, ökonomische, ‚imperialistische‘) Zwecke, ad absurdum führen.“ (Sama Maani: „Iran: Vergewaltigung als theologisches Problem“)