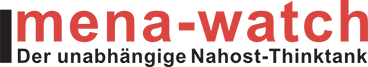Die Tötung des iranischen Terror-Paten Qassem Soleimani weckt die schmerzliche Erinnerung daran, dass die Amerikaner einst Deutschland besiegt haben.
Bobachter aus dem westlichen Ausland haben sich in den vergangenen Jahrzehnten schon öfter gewundert, warum in Deutschland und auch Österreich die Empörung immer besonders groß zu sein scheint, sobald im Nahen Osten amerikanische oder israelische Soldaten einem Despoten oder Massenmörder gewaltsam das Handwerk legen. Ob beim Sturz Saddam Husseins, Gaddafis oder bei der Eliminierung ranghoher Funktionäre von Hamas, Hisbollah, ja selbst von al-Qaida oder dem Islamischen Staat, die Reaktionen in deutschsprachigen Ländern fielen immer recht stereotyp aus.
Die einen mahnen, Gewalt sei nie eine Lösung, andere, die sich sonst dafür kaum zu interessieren scheinen, verweisen auf einen Bruch des Völkerrechts, dritte betonten, jedes Menschenleben sei schließlich gleich wertvoll. Und alle sind sich einig, dass natürlich der Frieden oder die Möglichkeit einer friedlichen Lösung von Konflikten gefährdet werde.
Ob es abgesehen von der angeblichen Sorge um den Frieden und das Völkerrecht am Ende nicht noch andere Motive gibt, die so viele so regelmäßig an die Seite von Diktatoren treiben, die alle nicht nur ihre eigene Bevölkerung unterdrücken und drangsalieren, sondern durch die Bank auch die Vernichtung Israels auf ihrer Agenda hatten und haben? Auch diese Frage stellten sich Beobachter aus dem westlichen Ausland. Und das ganz zu Recht. Will man wissen, was unbewusst viele umtreiben mag, wenn sie sich auch jetzt, nach der Ausschaltung von Qassem Soleimani im Irak, wieder empören, das Völkerrecht bemühen und/oder die Aggression der USA verurteilen, hilft manchmal ein Blick auf Seiten von Nazis wie dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der NPD.
Der nämlich schickte ein (mittlerweile wieder von seiner Facebook-Seite entferntes) Kondolenzschreiben an die iranische Regierung und das iranische Volk:

Abgesehen davon, dass Grammatik und Interpunktion dieser Auslassung das bekannte Zitat von Karl Kraus bestätigen, dass Deutsch die Sprache derer ist, „die zwar deutsch fühlen, aber nicht Deutsch können“: Man sollte dem Hauptmann der Reserve für die deutlichen Worte dankbar sein, helfen sie doch ein wenig dabei, das Geheimnis zu lüften, das sich hinter der deutschen Verehrung schnauzbärtiger Nahost-Führer verbirgt. Man glaubt fest, sich im gemeinsamen Kampf zu befinden, teilt dieselben Feinde. Kommt ein neuer Despot in der Region an die Macht und verspricht zu Ende zu führen, was die Alliierten im II. Weltkrieg gewaltsam beendeten, wird er umgehend zum neuen Hoffnungsträger.
Ob früher Gamal Abdel Nasser in Ägypten oder Saddam Hussein im Irak, ob panarabisch oder islamistisch, spielt dabei keine Rolle. Von allen, die antraten, dem Westen die Stirn zu bieten und Israel von der Landkarte zu radieren, ist heute kaum jemand mehr geblieben – außer eben dem iranischen Regime. Die Islamische Republik meint es mit ihren Zielen besonders ernst und kann sich deshalb auch eines solchen Zuspruchs erfreuen.
Natürlich gehen nur wenige so weit und wagen ähnlich offen auszusprechen, warum ihnen das Regime in Teheran so am Herzen liegt. Selbstverständlich würden die meisten anderen es weit von sich weisen, von ähnlichen Motiven angetrieben zu werden. Und doch lässt sich nicht von der Hand weisen, dass eine im Untergrund fortwirkende Nähe besteht, die sich immer wieder Ausdruck bahnt – und sich nicht nur bei hartgesottenen Rechtsextremen finden lässt, sondern auch aus so manchen Stellungnahmen aus den Reihen der deutschen Friedensbewegung spricht, wenn wieder einmal eine nahöstliche Führerfigur auf gewaltsame Art und Weise das Zeitliche gesegnet hat.