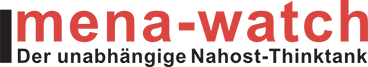Interview mit Tilman Tarach

Mercedes Nabert (MN): ARTE begründet die Nichtausstrahlung unter anderem damit, der Film habe vor allem den Antisemitismus im Nahen Osten im Visier und nicht den in Europa. Der Film wurde, neben Deutschland, Frankreich und Brüssel auch in Israel und den palästinensischen Gebieten gedreht, vor allem in Gaza. War diese Herangehensweise nicht sinnvoll? Was ist von dem Argument des Senders zu halten?
Tilman Tarach (TT): Die verbreitetste Spielart des europäischen Antisemitismus kann man heute ohne Bezug auf den Nahen Osten gar nicht verstehen, denn dabei wird der Antisemitismus an dortige Akteure sozusagen delegiert, und der Film zeigt dies schon in den ersten Minuten sehr schön: Zwar wird zunächst Palästinenserpräsident Mahmud Abbas vorgestellt, wie er letztes Jahr im EU-Parlament eine Art „Erlösungsantisemitismus“ propagierte, indem er erklärte, die Gewalt in nicht weniger als „der gesamten Welt“ werde verschwinden, sobald Israel die Besatzung der Westbank beende. Zudem behauptete er, israelische Rabbiner hätten gefordert, den Palästinensern das „Wasser zu vergiften, um Palästinenser zu töten“ – unnötig zu sagen, dass nichts davon wahr ist, Abbas selbst gab das einige Tage später zu – aber es handelt sich um eine Verleumdung, die über Jahrhunderte bis in die Neuzeit hinein zu blutigen Pogromen gegen Juden geführt hat.

MN: Der europäische Antisemitismus äußert sich also heute unter anderem in Form von so genannter Israelkritik, und hierbei wiederum zusätzlich dadurch, dass Akteuren aus dem Nahen Osten die Rolle zuteil wird, ihn auszuagieren. Dafür werden immer diejenigen ausgesucht, die am radikalsten – und dadurch leider oft auch am mächtigsten – sind. Welche Implikationen ergeben sich aus dieser „Delegation“, wie Du es nennst?
TT: Diese Delegation vollzieht sich unbewusst, und damit sie funktioniert, haben die Antisemiten hierzulande eine klare projektive und letztlich auch rassistische Erwartungshaltung gegenüber der vielbeschworenen sogenannten arabischen Straße. Man ist verärgert, wenn sie enttäuscht wird, wenn also beispielsweise – wie in dem Film gezeigt – Palästinenser in Gaza nicht in erster Linie Israel, sondern die Hamas kritisieren. Ich bin davon überzeugt, dass heimlich auch diese enttäuschte Erwartung eine Rolle bei der Ablehnung des Filmes gespielt hat.
MN: Doch längst noch nicht jeder Antisemitismus äußert oder verkleidet sich heute geopolitisch. Zum einen bezwecken diejenigen antizionistischen Akteure, die in ihrem Schreiben und Wirken genau wissen, was sie tun, ja eben das, dass es sich alles wieder dekodieren lässt und Rückschlüsse auf „den Juden“ entstehen. Zum anderen wissen wir, dass Jungen mit Kippah auch dann geschlagen werden, wenn sie nicht gerade die Hatikva singen.

Indessen werten deutsche Gerichte skandalöserweise selbst einen dezidiert antisemitischen Brandanschlag auf eine Synagoge strafmildernd als bloße „Israelkritik“, wenn die Täter palästinensischer Herkunft sind und einen Zusammenhang zum Nahen Osten herstellen.
MN: Wie ist der Vorwurf, der Beitrag enthalte „handwerkliche Fehler“, zu beurteilen?
TT: Es ist erstaunlich, mit welcher Akribie der Film nun an Qualitätsstandards gemessen wird, die bislang bei Beiträgen zum Antisemitismus oder dem Nahostkonflikt grob missachtet wurden. Zudem handelt es sich bisher lediglich um eine Rohfassung, etwaige Schwächen könnten problemlos nachgebessert werden, ein in der Branche absolut übliches Verfahren. Der Film wurde, davon bin ich überzeugt, nicht wegen seiner Schwächen, sondern wegen seiner Stärken abgelehnt.
MN: Am Mittwoch strahlt die ARD den Film aus – nachdem er schon öffentlich ist. Ist damit alles wieder gut?
Tilman Tarach: Wir werden sehen. Der Beitrag steht nach all dem Trubel ja eher im Ruche des „Umstrittenen“, was wahrscheinlich einen Teil seiner Wirkung zerstreut, weil sich der bequeme Zuschauer sagen kann: „Nun ja, die einen sagen so, die anderen so, die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte“. Und die anschließende Diskussion mit bislang unbekannten Teilnehmern dürfte eher zu einem Tribunal gegen die Produzenten des Filmes ausarten.