Ausgerechnet am 13. März möchte die deutsche Journalistin Charlotte Wiedemann in Wien ihr jüngstes, shoahrelativierendes Buch vorstellen – und beweist damit erneut mangelndes erinnerungspolitisches Fingerspitzengefühl.
Thomas Tews
»Der Tod ist ein Meister aus Deutschland.« Diese später zu einer Art literarischem Mahnmal gewordene Zeile schrieb Paul Celan unter dem Eindruck der Nachricht vom Tod seiner Eltern im SS-Lager Michailowka in der damals von der deutschen Wehrmacht und der SS besetzten Ukraine. Ihr Schicksal sowie das von sechs Millionen weiterer Jüdinnen und Juden veranlasste Hannah Arendt dazu, die Shoah als »das Verbrechen eines Völkermords, der in der Geschichte ohne Beispiel ist«, zu benennen. Der Historiker Saul Friedländer betont, die Shoah unterscheide sich »nicht nur in einzelnen Aspekten von anderen historischen Verbrechen, sondern fundamental«.
Diese Singularität wird von der Publizistin und Auslandsreporterin Charlotte Wiedemann in ihrem im vergangenen Jahr veröffentlichten Buch Den Schmerz der Anderen begreifen. Holocaust und Weltgedächtnis, das die Autorin ausgerechnet am 13. März, dem 85. Jahrestag des »Anschlusses« Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland, in Wien vorstellen möchte, infrage gestellt. Mangelndes erinnerungspolitisches Fingerspitzengefühl hatte Wiedemann bereits letztes Jahr bewiesen, als sie ihre Thesen am 9. November, dem Jahrestag der Reichspogromnacht, am Goethe-Institut in Tel Aviv präsentieren wollte – eine Veranstaltung, die auf öffentlichen Druck hin erst verschoben und dann ganz vertagt wurde.
Laut Wiedemann könne »das Beharren auf der Einzigartigkeit des Holocausts so wirken, als wolle Europa immer noch seine Geschichte über alle anderen stellen«. Sie kritisiert »eine Hierarchisierung von Opfern, die mit dem Attribut Singularität zwangsläufig« einhergehe und fordert, dass in der deutschen Erinnerungskultur dem »Schmerz der Anderen« – gemeint sind in erster Linie Palästinenser, deren als »Nakba« bezeichnete Flucht und Vertreibung mit dem Trauma der Shoah zu parallelisieren ihr ein besonderes Anliegen zu sein scheint – derselbe Stellenwert wie dem Leid der Shoah-Opfer und -Überlebenden beigemessen werden soll.
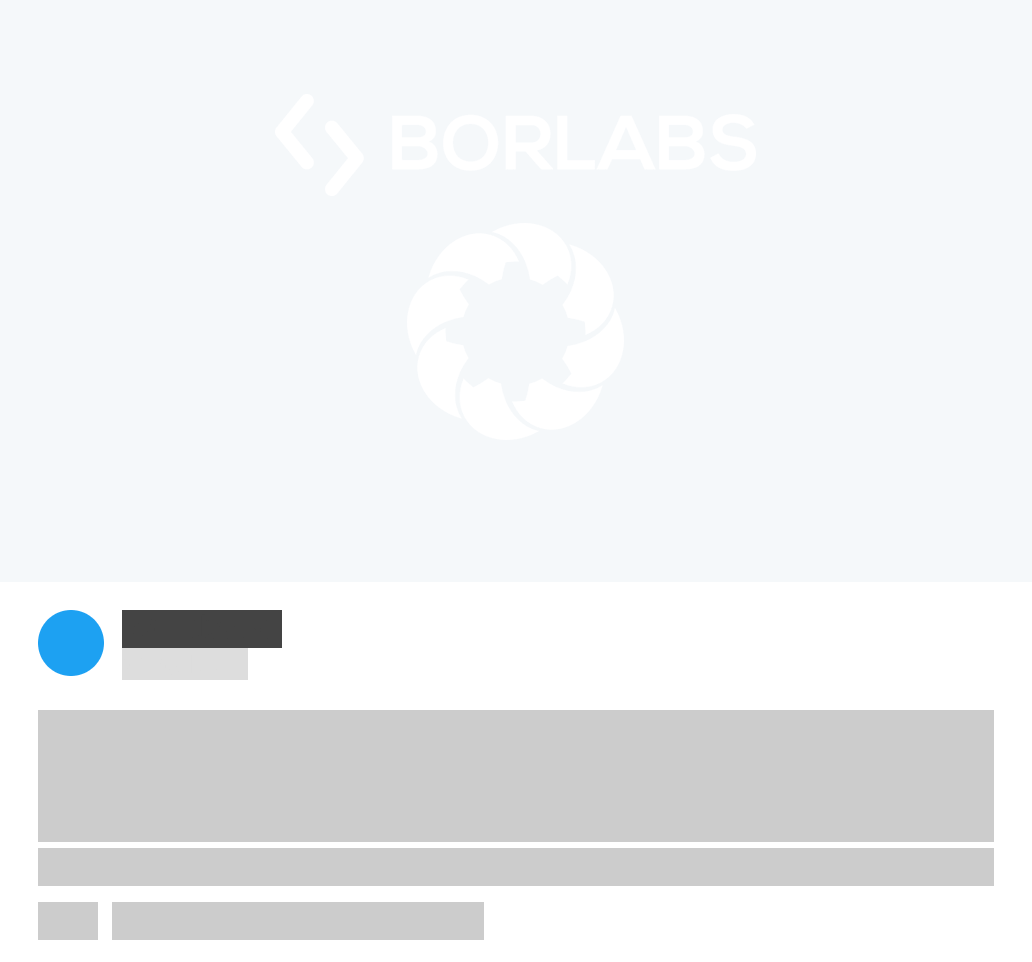
Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.
Mehr erfahren
Shoah-Relativierung
Das Stellen auf eine gemeinsame Stufe läuft letztendlich auf eine Relativierung der Shoah und eine Delegitimierung des Staates Israel hinaus. Letzterem wirft Wiedemann vor, »als Spätfolge der Shoah in Unrecht anderen gegenüber verstrickt zu sein«, wobei sie sich hier vor allem auf die »Nakba« bezieht. Da ihrer Meinung nach »die Ermordung der europäischen Juden und die palästinensische Nakba miteinander verflochten sind«, fordert sie für Letztere einen Platz in der offiziellen Erinnerungskultur Deutschlands: »Gerade, wenn der Holocaust als die alles andere überschattende Ursache der Staatsgründung betrachtet wird, wäre die Nakba auch ein Teil unserer Geschichte.«
Dies erinnert an ein am 10. September 2022 auf der von Antisemitismusskandalen erschütterten Kasseler Kunstausstellung documenta fifteen aufgetauchtes Poster mit dem Slogan »Nakba is a part of Erinnerungskultur«, das laut Susanne Urban, Leiterin der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) Hessen, »von dem Versuch, die ›Nakba‹ mit den nationalsozialistischen Verbrechen und der Shoah gleichzusetzen, was wiederum eine Relativierung nach sich zieht«, zeugt.
Eine solche Relativierung par excellence hatte ein paar Wochen zuvor der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, vorgeführt, als er während eines Staatsbesuchs in Deutschland auf einer Pressekonferenz im Kanzleramt in geschichtsrevisionistischer Weise behauptete, Israel habe seit 1947 »fünfzig Holocausts« begangen.
Aber auch Wiedemanns auf den ersten Blick harmlos scheinende Forderung, »eine inklusive Erinnerungskultur» zu schaffen, »in der es keine Hierarchie von Leiderfahrung mehr gibt«, impliziert eine Relativierung der Shoah. Diese geht mit einer Skepsis gegenüber der deutschen »Identifikation mit dem jüdischen Staat« einher, welche für Wiedemann »ein zentrales Element deutschen Erlöst-Seins« darstellt.
Auch wenn dieser Befund für Teile der deutsche Erinnerungspolitik zutrifft – wie Eike Geisel oder Wolfgang Pohrt bereits vor vielen Jahren und viel treffender kritisiert haben als etwa Wiedemann –, bleibt die Solidarität mit dem einzigen jüdischen Staat, der für Juden weltweit als sicherer Hafen und Zufluchtsort vor Antisemitismus und Verfolgung fungiert, eine richtige und wichtige Schlussfolgerung aus der Shoah. Israels Funktion als Schutzmacht jüdischen Lebens zeigte sich beispielsweise 1984 in der Operation Moses, in der etwa 6.500 äthiopische Juden aus dem Sudan nach Israel geflogen wurden.
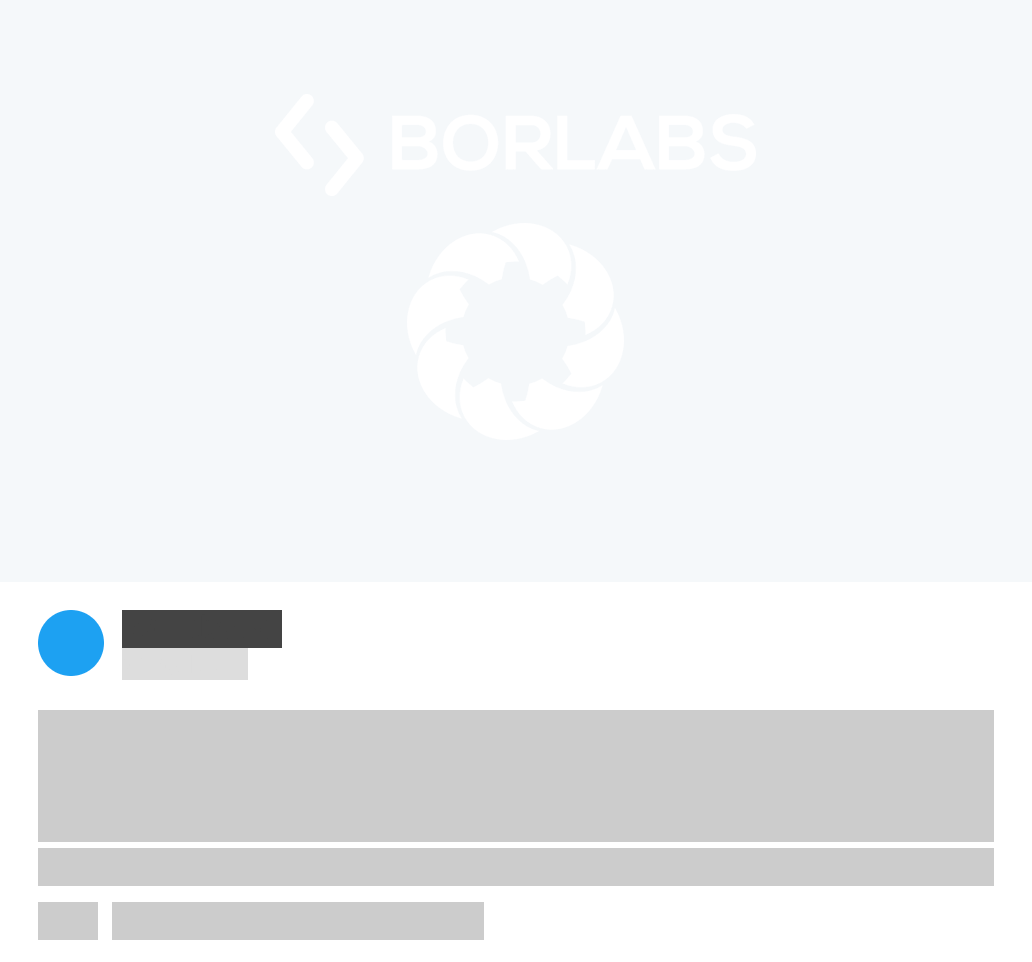
Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.
Mehr erfahren
Wiedemanns Aufruf zu »Israelkritik«
Es ist gut und richtig, empathisch den »Schmerz der Anderen« wahrzunehmen, aber dies sollte nicht mit der Erinnerung an das in der Menschheitsgeschichte (bislang) präzedenzlose Verbrechen der Shoah vermengt werden. Aus Letzterer lässt sich vieles, aber kein Auftrag zur »Israelkritik« ableiten, auch wenn dies leider (wieder) in Mode geraten zu sein scheint, wie ein in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit erschienener Beitrag von Shimon Stein und Moshe Zimmermann zeigt, in dem die Autoren die deutsche Bundesregierung zu einem Israelboykott in Form einer Aussetzung der jährlichen deutsch-israelischen Regierungskonsultationen aufrufen und dies mit der Shoah begründen: »Gerade die Erinnerung an die NS-Zeit erfordert einen werteorientierten Umgang auch mit Israel.« Diese politische Instrumentalisierung des Gedenkens an die Shoah, der auch von Wiedemann Vorschub geleistet wird, wäre wohl kaum im Sinne des eingangs zitierten Shoah-Überlebenden Celan gewesen.
Problematisch an Wiedemanns Buch ist auch ihre Verharmlosung von Antizionismus, die in der Zitierung eines Aktivisten, der die »Opposition zum Zionismus« zu einem »Projekt der Liebe« verklärt, gipfelt. Dazu, was Antizionismus tatsächlich bedeutet, fand der Historiker und Publizist Michael Wolffsohn deutliche Worte: »Antizionismus beziehungsweise Antiisraelismus ist Antisemitismus, denn: Israel ist die existenzielle Lebensversicherung aller Juden.« In Abwandlung eines bekannten Adorno-Zitats ließe sich daher postulieren: »Nach Auschwitz antizionistisch zu sein, ist barbarisch.«
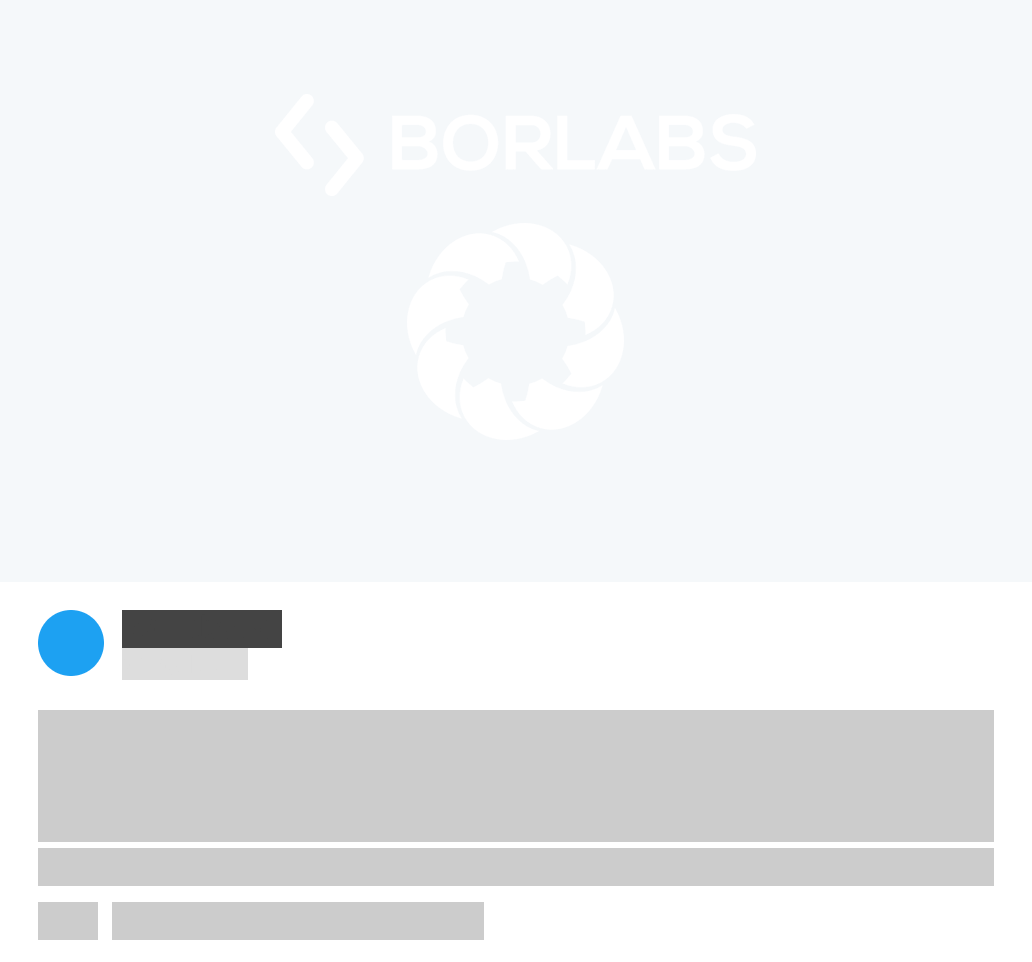
Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.
Mehr erfahren







