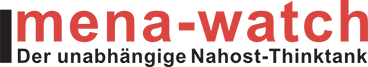Von Thomas von der Osten-Sacken

Und das in einem Land, das sich in einer tiefen ökonomischen Krise befindet, in dem die Jugendarbeitslosigkeit extrem hoch ist – fast die Hälfte aller Jugendlich gibt an, dass sie am liebsten emigrieren würde – und das immer wieder von islamistischem Terror heimgesucht wird. Rosig also sieht es in Tunesien nicht aus, auch über regelmäßige Menschenrechtsverletzungen und sogar Folter im neuen Tunesien wird immer wieder berichtet.
Nach europäischem Maßstäben also müssten sich eigentlich immer mehr Tunesier von ihrem Glauben an die Demokratie abwenden, denn, die jüngsten Entwicklungen in Ungarn, Österreich, Deutschland und Frankreich zeigen es zur Genüge, in Europa gilt, dass Zustimmung zu demokratischen Regierungsformen offenbar sehr eng mit Wohlstand, Sicherheit und Wirtschaftswachstum zusammenhängt.

Die Ergebnisse der Umfrage widerlegen auch all jene, die immer wieder behaupten, in der arabischen Welt wollten die Menschen qua kultureller und/oder religiöser Zugehörigkeit ja gar nicht in demokratischen Verhältnissen leben oder wären dazu gar nicht in der Lage. Wenn, dann scheint die zweite, in Europa so oft herablassend vorgebrachte Unterstellung, noch größeren Wahrheitsgehalt zu haben, denn immerhin 73% der befragten Tunesier meinen, ihre Landsleute seien noch nicht „ready for democracy“.
Natürlich wird man, verbreiteten sich die Ergebnisse des Arab Barometers, bald zu hören bekommen, Tunesien sei ja auch eine Ausnahme, ganz anders als etwa Libyen und Syrien, wo der sogenannte arabische Frühling so kläglich gescheitert sei und die Länder in blutiges Chaos gestürzt habe. In Tunesien, da hätte es ja einen hohen Bildungsstand gegeben, da seien die Gewerkschaften weitgehend unabhängig geblieben und die Frauen weit weniger unterdrückt worden. Und das alles stimmt natürlich: Auch wenn Ben Ali mit äußerster Härte politische Dissidenz unterdrückte und maßlos korrupt war, unterschied sich Tunesien durchaus von vielen anderen arabischen Ländern.
Daher gilt es, den Umkehrschluss zu ziehen: Je weniger totalitär ein Land regiert wurde, umso größer scheinen die Chancen, dass es sich langfristig zu transformieren in der Lage ist. Ben Ali hat die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Strukturen Tunesiens zwar nachhaltig beschädigt und eine Erbschaft hinterlassen, unter der die Tunesier noch Jahrzehnte zu leiden haben werden, er hat sie aber nicht völlig zerstört, wie seine Diktatorenkollegen in Syrien, Libyen und dem Irak.
Tunesien war eben kein „failed state“ in spe, der nur noch mit harter Hand und äußerster Brutalität irgendwie zusammengehalten wurde. Leider aber wird man in Europa aus den tunesischen Umfrageergebnissen wohl nur herauslesen, dass es hoffnungslos sei, sich auch für grundlegende Veränderungen in den anderen, gescheiterten arabischen Staaten einzusetzen, und dass man dort vielmehr auf Stabilität und starke Männer bauen müsse. Chronischer Alkoholismus, so diese Logik, sei am besten mit noch mehr Schnaps zu bekämpfen.

Und wie ist es mit dem Islam? Der türkische Präsident Erdogan, der gerade im eigenen Land in rasantem Tempo ein autokratisches System zu errichten versucht, erklärte ja auch immer, er handle ganz demokratisch, da mehr als 50% der Bevölkerung ihn gewählt hätten. Die AKP galt lange Zeit sogar als leuchtendes Beispiel dafür, wie gut Islam und Demokratie sich vereinbaren ließen. Ist eine solche Verbindung, was den Tunesiern vorschwebt?
Wenig spricht dafür, auch wenn in den Interviews nicht nach dem Verhältnis von Staat und Religion gefragt wurde. Aber ein anderes Ereignis, das dieser Tage in Tunis stattfand, ist recht erhellend.
Die islamistische Ennadha-Partei, der tunesische Arm der Muslimbrüder also, lud nämlich zu einem Kongress, auf dem ihr Vorsitzender erklärte, dass man fortan Politik und Religion strikt voneinander trennen müsse und wolle. „Die Ennadha Partei hat sich erst von einer ideologischen Bewegung (…) in eine Protestbewegung gegen ein autoritäres Regime verwandelt und ist nun zu einer national-demokratischen Partei geworden“, so Rashid Ghannouchi
Nun sollte man sich vor dem Glauben hüten, dass Islamisten so etwas wirklich ernst meinen. In Situationen der Schwäche oder wenn sie in die Defensive geraten, bekommt man von ihrem ‚gemäßigten‘ Flügel immer wieder ähnliche Töne zu hören – von denen also, die nicht den bewaffneten Jihad predigen. Die gute Nachricht besteht also weniger in der vermeintlichen Einsicht, die Ennadha nun zeigt, sondern darin, dass sie sich erstens in der Defensive sieht, deshalb zweitens Zugeständnisse machen muss und diese drittens in eine ganz andere Richtung weisen, als etwa die Entwicklung der AKP in der Türkei.