Die Motive für das alljährliche öffentliche Gedenken an den Holocaust sind vielfältig. Nicht alle sind ehrenwert.
Es war eine berührende Rede, die Israels Außenminister Yair Lapid am Internationalen Holocaust-Gedenktag in Mauthausen gehalten hat.
»The Nazis thought they were the future, and that Jews would be something you only find in a museum. Instead, the Jewish state is the future, and Mauthausen is a museum. Rest in peace, grandfather, you won.«
(Eine deutsche Übersetzung der ganzen Rede finden Sie hier.)
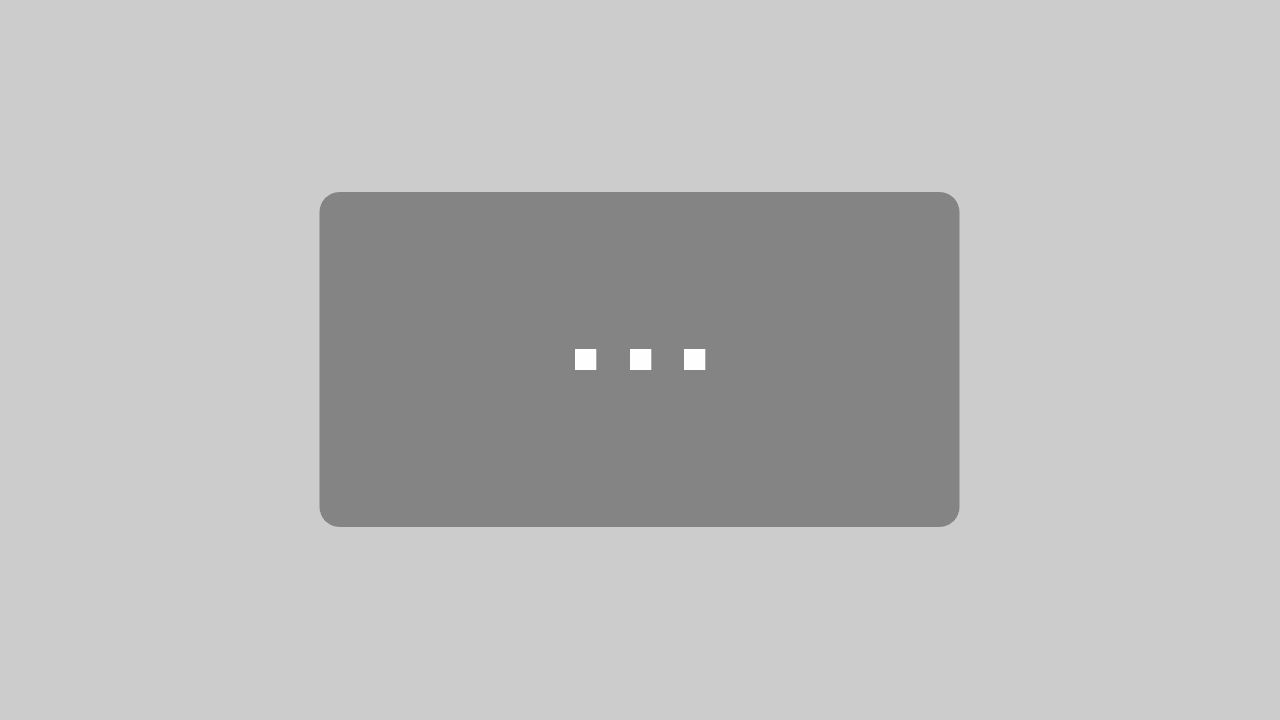
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Der österreichische Kanzler Karl Nehammer entschuldigte sich, die beiden umarmten einander, hier standen nicht zwei Politiker, die eine protokollarische Pflichtübung absolvierten, sondern zwei Männer, deren persönliche Geschichte miteinander verknüpft ist. So wie meine. Mein Großvater war Mitglied der NSDAP. Ein kleines Licht, wie man so sagt, aber ohne die Millionen kleinen Lichter hätte das große Feuer nicht gebrannt.
Darum gedenken wir – in liebevollem Schmerz der Opfer, in verständnislosem Schmerz der Täter. Großvater, wie konntest du nur?
Gedenken, so es denn aufrichtig ist, ist immer auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, der familiären ebenso wie jener des Landes. Die Nachkommen der Täter müssen den Umstand ertragen, dass der Mann, den sie persönlich als liebevollen Großvater in Erinnerung haben, an der Seite jener stand, die dem Freund den Großvater geraubt haben. So schwer das fällt, so leicht wiegt es im Vergleich dazu, sich nicht bei jedem Österreicher oder Deutschen zu fragen, was dessen Großvater wohl der eigenen Familie angetan haben mag.
Gedenken mit schuldbefreiender Wirkung
Gedenken, das inszenierte und allzu oft ritualisierte zumal, vermag aber auch in einem Akt der Katharsis den Gedenkenden von Gefühlen der Schuld und Scham zu befreien und sich auf diese Weise der eigenen Vergangenheit zu entledigen. Dieses Gedenken mit schuldbefreiender Wirkung dient nicht den Opfern, sondern ausschließlich den Tätern, auf der persönlichen Ebene ebenso wie auf der staatlich-politischen.
Beim fünfjährigen Jubiläum des Holocaust-Mahnmals in Berlin sprach der anderweitig durchaus verdiente deutsche Historiker Eberhard Jäckel den Satz:
»In anderen Ländern beneiden manche die Deutschen um dieses Denkmal. Wir können wieder aufrecht gehen, weil wir aufrichtig waren. Das ist der Sinn des Denkmals, und das feiern wir.«
Klarer kann man nicht zum Ausdruck bringen, dass diese Art des Erinnerns nur für die Erinnernden da ist, nicht für die Erinnerten und die Vergessenen. Ohne Holocaust kein Holocaust-Denkmal, nichts daran ist beneidenswert. Sühnestolz ist ein Widerspruch in sich, denn der Sühne geht immer eine Schuld voraus.
Schuld und Scham sind nicht dazu angetan, die Geschichte des eigenen Landes oder der eigenen Familie zu bewältigen, sie sind nur die andere Seite der Medaille, die man Nationalstolz nennt. Ich fühle mich ebenso wenig schuldig für meinen Großvater wie ich stolz sein kann auf Franz Klammers Abfahrtssiege oder Egon Schieles Gemälde. Nicht meine Tat das eine, nicht meine Leistung das andere. Aber beides ist Teil meiner Geschichte, Teil meiner Identität.
Das nationale historische und kulturelle Erbe ist unteilbar. Die Lipizzaner, Mozart und Maria Theresia sind ohne Hitler und Kaltenbrunner nicht zu haben. Die Nachkommen von Tätern und Opfern sind durch die Shoah miteinander verstrickt. Der Umgang mit dem eigenen Erbe entscheidet darüber, ob aus der Verstrickung Verbundenheit wird.
Erinnern
Erinnerung ist selektiv und lückenhaft. Und das oft durchaus absichtsvoll:
»Ich erinnere mich halt auch, wie man sich damals, als es noch brisant war, absolut nicht erinnern wollte. Wie man die Kindermörder, Frauenmörder, Männermörder, Menschenmörder so was von absichtlich nicht gesucht hat, um sie doppelt absichtlich nicht zu finden.«
Götz Schrage
Dies schrieb der Wiener Fotograf Götz Schrage gestern auf Facebook zum Tag des Erinnerns und traf damit nicht nur einen wunden Punkt, sondern mitten ins Schwarze.
Quer durch alle politischen Lager wurde in Österreich jahrzehntelang verleugnet, verdrängt, verharmlost und vertuscht. Und Göttin Justitia war nicht einfach blind, sie schaute weg.
Ich erinnere mich an die Artikel von Viktor Reimann und Richard Nimmerrichters »Staberl«-Kolumnen in der Kronen Zeitung, die wohl nicht zuletzt ihrer täglichen Geschichtsklitterung zu verdanken hatte, dass sie im Verhältnis zur Einwohnerzahl zur auflagenstärksten Zeitung der Welt wurde.
Ich erinnere mich an die Aufnahmen vom Prozess gegen den »Schlächter von Wilna«, Franz Murer, an die Verhöhnung der jüdischen Opfer, an den skandalösen Freispruch unter dem Gejohle des Publikums. Murer starb 1994 als Bezirksbauernvertreter der ÖVP.
Ich erinnere mich an Bruno Kreisky, der dem SS-Obersturmbannführer Friedrich Peter die Hand reichte und gleichzeitig Simon Wiesenthal aufs Schäbigste verleumdete. Der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer erinnert sich sicher auch daran. An dieser Stelle beende ich die Aufzählung, die Liste wäre ohnehin viel länger als mein Gedächtnis reicht.
Nie wieder?
Öffentliches Gedenken mahnt in Österreich und Deutschland immer das »Nie wieder« ein. Man darf bezweifeln, ob es diesen Zweck erfüllt. Zum einen dient es, wie oben beschrieben, öfter den Tätern als den Opfern, zum anderen ist die Shoah für einen immer größer werdenden Teil der Bevölkerung nicht mehr Teil der eigenen Geschichte.
In Wien haben über 60 Prozent der Schüler Migrationshintergrund, in ganz Österreich fast ein Viertel der Einwohner. Ihnen fehlt die Verknüpfung der Schicksale von Opfern und Tätern mit der eigenen Familiengeschichte. Für sie ist die Shoah ein Verbrechen fremder Menschen aus vergangenen Zeiten, ein historisches Ereignis, wie die Feldzüge Napoleons oder der Erste Weltkrieg.
Auf akademischer Ebene spiegelt sich diese Entwicklung wider, indem der Holocaust relativiert wird. Theoretiker des Postkolonialismus wie der Historiker Dirk Moses sprechen ihm seine Singularität ab, für sie ist er nicht nur ein Verbrechen unter vielen, sondern eines, das den Blick auf andere Verbrechen des Westens verstellt.
In Wahrheit verstellt der Blick auf die toten Juden den Blick auf die lebenden. Womit wir bei Israel wären. Und der »besonderen Verantwortung« für den jüdischen Staat, die sich aus unserer Geschichte angeblich ergebe. Als ob man sechs Millionen Juden ermordet haben müsste, um an Israels Seite zu stehen.
Diese Phrase setzt die selbstverständliche Solidarität mit einem demokratischen Rechtsstaat zu einer Notwendigkeit herab, die auf dem schlechten Gewissen für die eigene Vergangenheit beruht statt auf eigenen Interessen und der Anerkennung der herausragenden wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und zivilisatorischen Leistung Israels in der Gegenwart.
Es obliegt den Nachkommen der Täter, das historische Erbe unserer Nation zum persönlichen zu machen. Auch deshalb waren die Bilder von der Umarmung der beiden Männer in Mauthausen so berührend.
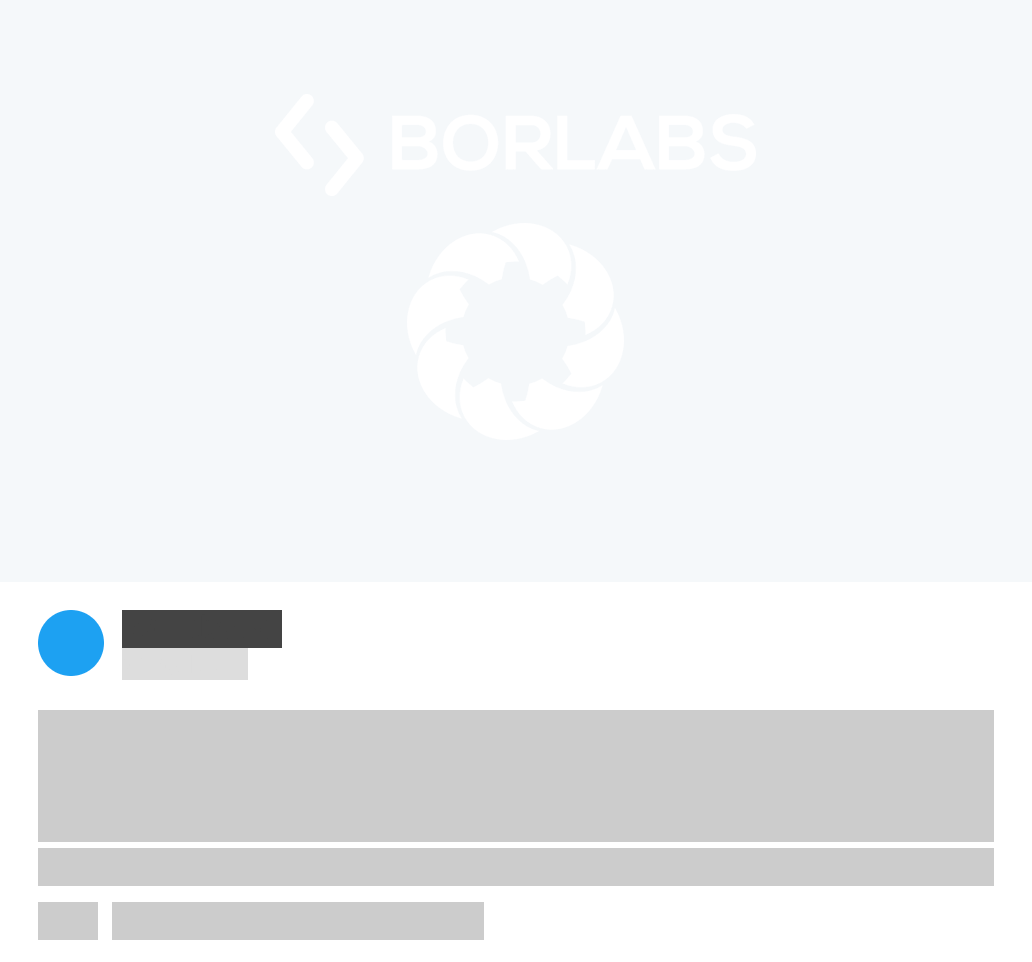
Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.
Mehr erfahren
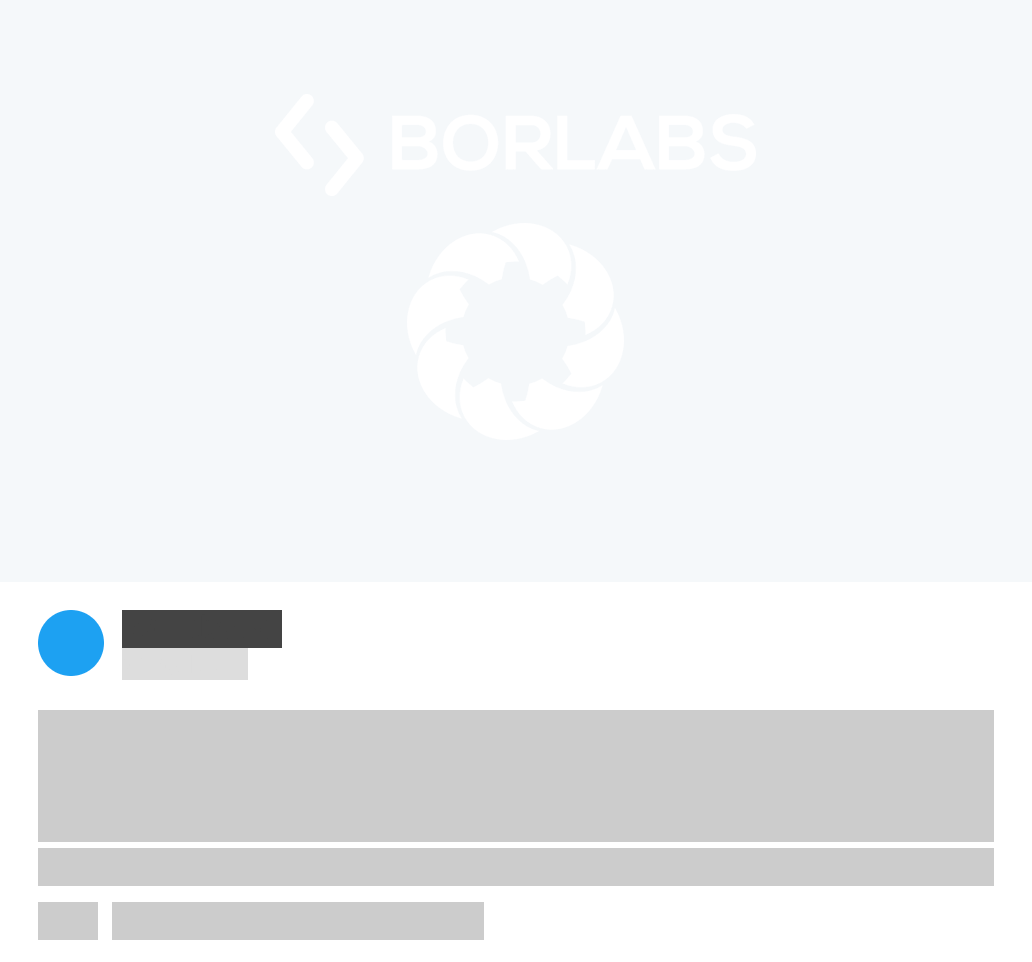
Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.
Mehr erfahren







