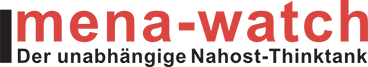Niels Annen, der parlamentarische Staatssekretär des deutschen Außenministers Heiko Maas, führt gerne Dialoge – vor allem mit jenen, die dem jüdischen Staat den Garaus machen wollen. Genau das entspricht der Leitlinie der deutschen Nahostpolitik. Konsequenzen müssen die Feinde Israels nicht fürchten, denn die deutsche Solidarität mit Israel ist kaum mehr als ein Lippenbekenntnis.
Wenn man eine Vorstellung davon bekommen will, wie sich die deutsche Nahostpolitik derzeit darstellt, dann hilft ein Blick auf die jüngste Nahostreise von Niels Annen weiter. Der 46-jährige Sozialdemokrat ist seit März des vergangenen Jahres parlamentarischer Staatssekretär im Auswärtigen Amt, im Februar dieses Jahres geriet er in die Kritik, weil er in der iranischen Botschaft in Berlin an den Feierlichkeiten des islamistischen Regimes zum 40. Jahrestag von dessen Machtübernahme teilnahm. „Geschmacklos und geschichtsvergessen“ nannte das der aus dem Iran stammende FDP-Parlamentarier Bijan Djir-Sarai, man dürfe nicht vergessen, dass bei solchen Veranstaltungen regelmäßig antiamerikanische und antiisraelische Parolen gerufen würden. „Dass hier ein deutscher Staatssekretär dabei ist, sendet eine fatale Botschaft“, sagte er.
Das mochte Annen nicht einsehen. „Wir reden mit dem Iran – unter großem Druck – auch über die regionale Politik, über die Unterstützung für terroristische Organisationen, die zum Beispiel gegen Israel ausgerichtet sind“, erwiderte er. Man brauche „das Offenhalten von Dialogmöglichkeiten mit Teheran“, und deshalb „bereue ich da gar nichts“. Dass er sich ausgerechnet in der Botschaft anlässlich des Jubiläums der „Islamischen Revolution“ im Iran von 1979 als proisraelischer Party-Pooper präsentiert hat, darf man wohl für eine abwegige Vorstellung halten. Mit dem Besuch dieser Veranstaltung hat der Staatsminister ein Regime aufgewertet, das Zeit seiner Existenz nicht nur den jüdischen Staat mit der Vernichtung bedroht, sondern auch Abertausende im eigenen Land und jenseits der Staatsgrenzen verfolgt, gefoltert und ermordet hat.
Auch die antisemitische Hisbollah soll vom Dialog nicht ausgeschlossen werden, findet Annen, schließlich sei sie „ein relevanter gesellschaftlicher Faktor“ und ein „Teil der komplexen innenpolitischen Lage im Libanon“ sowie „im Parlament vertreten und Teil der Regierung“. Anders als Großbritannien, das die Gotteskriegertruppe als Ganzes zu einer Terrororganisation erklärt hat, halte Deutschland daran fest, als solche nur ihren „militärischen Teil“ einzustufen. Man könnte sich bei so viel Gesprächsbereitschaft fragen, ob die Gegenseite eigentlich auch irgendwann mal so etwas wie ein Entgegenkommen gezeigt hat, oder ob sie den Dialog lediglich als Schwäche des Westens betrachtet, als etwas, das sie Zeit gewinnen lässt und wodurch weder ihre Ziele noch ihre Praktiken in Frage gestellt werden.
Über den Anti-BDS-Beschluss des Bundestages setzt sich Annen hinweg

Doch das wird konterkariert, wenn man sich nicht nur mit fragwürdigen palästinensischen Politikern wie Saeb Erekat und Nabil Shaath trifft, die Israel für einen „Apartheidstaat“ halten, sondern mit Al-Haq auch einer palästinensischen NGO die Aufwartung macht, die zu den führenden Organisationen der antisemtischen BDS-Bewegung gehört und deren Direktor Shawan Jabarin vom Obersten Gerichtshof Israels zu den wichtigen Aktivisten der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) gerechnet wird, die im jüdischen Staat, in der EU und in den USA auf der Liste der Terrororganisationen steht. Palästinensische NGOs wie Al-Haq fürchten, dass der Anti-BDS-Beschluss des Deutschen Bundestages auch für sie und ihre deutschen Kooperationspartner Konsequenzen haben wird. Womöglich – leider – zu Unrecht, denn Niels Annen hat Al-Haq zufolge beschwichtigt: Der Bundestagsbeschluss sei „kein Gesetz“ und stehe „einer Unterstützung der palästinensischen Zivilgesellschaft nicht im Weg“, habe er beim Treffen versichert.
Dass Annen mit der Resolution nicht so recht einverstanden ist, wurde bereits bei ihrer Verabschiedung deutlich: Er gehörte zu jenen Parlamentariern, die eine zusätzliche Erklärung abgaben und ins Plenarprotokoll aufnehmen ließen, in der es hieß, durch den Beschluss dürfe „eine kritische und konstruktive Auseinandersetzung hier in Deutschland und vor Ort“ nicht unterbunden werden. Außerdem wolle man weiterhin unbedingt „auch die fortdauernde Besatzung und die drohende Annexion palästinensischer Gebiete, de[n] völkerrechtswidrige[n] Siedlungsbau und die Blockade des Gaza-Streifens durch Israel“ kritisieren. Als ob irgendjemand die betreffenden Abgeordneten daran hindern würde, dieser Obsession zu frönen, die sie so nur gegenüber dem jüdischen Staat an den Tag legen.
Niels Annen findet ausweislich eines Tweets auch den offenen Brief von 45 jüdischen Gelehrten „lesenswert“, die im Rücktritt des Direktors des Jüdischen Museums Berlin, Peter Schäfer, einen Beweis für „die zunehmende Zensur der Meinungsfreiheit und die abnehmende Möglichkeit, Regierungspolitik zu kritisieren oder auch nur in Frage zu stellen“, sehen. Dabei gab es für diesen Rücktritt gute Gründe, nachdem das Museum sich zum wiederholten Male auf der Seite der Feinde Israels positioniert hatte und schon vorher in die Kritik geraten war, weil es Referenten eingeladen hatte, die beispielsweise Verbindungen zu den antisemitischen Muslimbrüdern haben oder für einen Boykott Israels eintreten. Die Positionierung des Außenpolitikers Annen in dieser innenpolitischen Angelegenheit unterstreicht, dass die „Israelkritik“ offenbar eine Herzensangelegenheit für ihn ist.
Treffen mit der (anti)israelischen Fundamentalopposition

Was ihn anscheinend nicht störte, sind Tatsachen wie diese: B’Tselem hat Israel in der Vergangenheit unter anderem als „Apartheidstaat“ verunglimpft und ihm zudem vorgeworfen, Nazimethoden anzuwenden. Ende des Jahres 2014 geriet die Vereinigung in die Kritik, weil einer ihrer Aktivisten dem amerikanisch-israelischen Publizisten Tuvia Tenenbom vor laufender Kamera sagte, der Holocaust sei „eine Lüge“ und „eine Erfindung der Juden“. B’Tselem dementierte die Äußerung zunächst, dann erfolgte eine halbherzige Distanzierung und erst später die Ankündigung, sich von dem Mitarbeiter zu trennen. Für Aufsehen sorgte auch der Versuch eines palästinensischen Mitarbeiters der NGO, gemeinsam mit einem israelischen Aktivisten einen Araber, der im Westjordanland privaten Grundbesitz an Juden verkaufen wollte, in eine Falle zu locken. Dort wäre er von palästinensischen Sicherheitskräften festgenommen worden, und ihm hätte die Todesstrafe gedroht.
B’Tselem ist zu einer Vereinigung geworden, die nahezu jede Tätigkeit der israelischen Armee und jedes israelische Regierungshandeln gegenüber den Palästinensern für prinzipiell illegitim, ja, illegal hält und sich nicht scheut, mit Kräften zu kooperieren, die dem jüdischen Staat nach seiner Existenz trachten. Einer ihrer Hauptaktivisten etwa, Adam Aloni, sprach im September 2017 in Frankreich auf einer radikal antiisraelischen Konferenz, die den Titel „Von der Balfour-Deklaration bis heute: eine koloniale Tragödie“ trug, und stellte in Abrede, dass Israel eine Demokratie ist. Bereits im Juni 2017 hatte B’Tselem-Direktor Hagai El-Ad auf einer Veranstaltung des Komitees der Vereinten Nationen für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes behauptet, die israelische Regierung setze den Vorwurf des Antisemitismus gezielt ein, um Kritiker ihrer Politik zum Schweigen zu bringen.
Die 1989 gegründete Organisation hat längst ihr ursprüngliches Ziel aus den Augen verloren, vermeintliche oder tatsächliche israelische Rechtsverstöße in den umstrittenen Gebieten zu dokumentieren, um die israelische Öffentlichkeit sowie Entscheidungsträger zu informieren und gesellschaftskritisch in Diskussionen zu intervenieren. B’Tselem trug im Jahr 2009 zum unsäglichen Goldstone-Bericht des notorischen UN-Menschenrechtsrates bei und spielte fünf Jahre später, während des Gaza-Krieges im Sommer 2014, eine wesentliche Rolle bei der Verbreitung überhöhter Zahlen in Bezug auf getötete palästinensische Zivilisten. Das Datenmaterial, über das die NGO verfügte, stammte dabei ausschließlich aus palästinensischen Quellen und erwies sich als nicht verifizierbar. Zudem rechnete B’Tselem in mehreren Fällen fälschlich palästinensische Kombattanten zu den Zivilisten.
Die Feinde Israels haben von den Deutschen nichts zu befürchten

So sehen sie aus, die Prioritäten des parlamentarischen Staatssekretärs von Heiko Maas, also jenes Außenministers, der bei seinem Amtsantritt erklärt hatte, er sei „wegen Auschwitz in die Politik gegangen“. Die oft und gerne beschworene Solidarität mit Israel ist und bleibt vor allem eine Worthülse, ein Lippenbekenntnis. Zur deutschen Staatsräson gehört vielmehr die „Israelkritik“. Der Iran, die Hisbollah, die palästinensische Führung, palästinensische BDS-Organisationen, fundamentaloppositionelle israelische NGOs – sie alle können sich der Gesprächsbereitschaft und der verständnisvollen Aufmerksamkeit von Niels Annen sicher sein. Einschneidende Konsequenzen müssen sie nicht fürchten, im Zuge der Abgrenzung von den USA ist die deutsche Außenpolitik noch weniger dazu bereit als vorher schon. Aber dass man sich auf die Deutschen als Partner nicht verlassen kann und nichts von ihnen erwarten kann, weiß man in Israel schon lange.