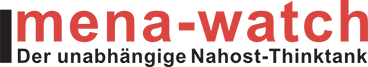Von Florian Markl

Trump, der Jacksonian …
Die Verwirrung betrifft die grundlegende außenpolitische Linie Trumps. Der Präsident hat sich mit „America First“ zwar den Slogan der Isolationisten zu eigen gemacht, die einst einen Rückzug Amerikas von der internationalen Bühne forderten, steht tatsächlich aber nicht in dieser außenpolitischen Tradition. Der stets lesenswerte Walter Russell Mead hat in seinem Buch „Special Providence. American Foreign Policy and How It Changed the World“ vier Traditionslinien amerikanischer Außenpolitik identifiziert. Eine davon sind die sogenannten Jacksonians, benannt nach dem 7. Präsidenten der USA, Andrew Jackson, der von 1829 bis 1837 regierte und als der erste Populist unter Amerikas Präsidenten gilt.
Jacksonians richten ihr Hauptaugenmerk auf das eigene Land und vertreten protektionistische Positionen. Sie interessieren sich nicht wirklich für Außenpolitik und halten nicht viel von militärischen Interventionen mit aus ihrer Sicht überzogenen politischen Zielen, wie etwa dem Versuch, Demokratie in alle Welt zu exportieren oder im Ausland Nation Building zu betreiben. Sie lehnen, hier hat Wergin recht, die Vorstellung ab, dass die USA die Rolle des Weltpolizisten an Schauplätzen spielen sollten, an denen das eng definierte nationale Interesse oder die Sicherheit der Vereinigten Staaten nicht unmittelbar auf dem Spiel stehen.
Das macht Jacksonians aber nicht zu Isolationisten, denn sie engagieren sich punktuell sehr wohl auf der internationalen Bühne: Wenn die USA angegriffen werden oder die Jacksonians den Eindruck haben, das Land werde hintergangen, sind sie die ersten, die instinktiv zur Verteidigung Amerikas mit aller verfügbaren Macht bereitstehen.
Trump ist in vielerlei Hinsicht – nicht zuletzt auch mit seinem impulsiven Charakter – ein geradezu klassischer Jacksonian; sein Erfolg wird von Walter Russell Mead in der jüngsten Ausgabe von Foreign Affairs denn auch als „The Jacksonian Revolt“ beschrieben.
… fühlt sich von Assad hintergangen
Gerade weil Trump in dieser außenpolitischen Tradition steht, bedeutet der von ihm befohlene Angriff auf den syrischen Flughafen, von dem die Flugzeuge der jüngsten Giftgasattacken in der Provinz Idlib gestartet sein sollen, keinen 180-Grad-Kurswechsel. Und er steht nicht im Widerspruch dazu, dass mehrere Vertreter der Trump-Regierung unlängst von der Forderung nach einem Abgang Assads abgerückt sind. Ganz im Gegenteil.
Nachdem Trump Assad erst vor wenigen Tagen eine Brücke gebaut hat und ihm ausrichten hat lassen, dass der Abgang des Diktators nicht mehr auf der Tagesordnung stehe, betrachtet er den Giftgaseinsatz in Khan Scheikhoun als persönliche Beleidigung. Trump fühlt sich von Assad hintergangen und brüskiert – und das lassen Jacksonians wie er nicht mit sich machen. Wenn man sich dazu noch vor Augen hält, wie persönlich nachtragend Trump selbst bei völlig belanglosen Kleinigkeiten ist, kommt der von ihm befohlene Militärschlag alles andere als überraschend. Auch dass er so schnell geschehen ist – Wergin spricht von einem „der schnellsten Vergeltungsschläge der Geschichte“ –, passt bestens ins Bild: Jacksonians wollen von der Welt in Ruhe gelassen werden, aber wenn sie sich herausgefordert fühlen, reagieren sie rasch und impulsiv.
So prompt Trumps Reaktion auf Assad in Form von 59 Marschflugkörpern erfolgte, die von Kriegsschiffen im Mittelmeer aus abgefeuert wurden, so schnell wird die militärische Intervention auch wieder vorüber sein. Nichts spricht momentan dafür, dass Trump, abgesehen von den bereits in Syrien operierenden amerikanischen Soldaten, ein längerfristiges militärisches Engagement gegen das Assad-Regime ins Auge fasst. Jacksonians haben kein Problem mit einer kurzen Demonstration militärischer Stärke, aber das dürfte es dann auch schon gewesen sein.