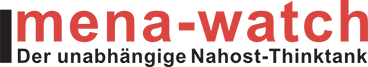Die anfänglichen wirtschaftlichen Erfolge hatte Erdogan dem IWF zu verdanken. Seine obsessive Niedrigzinspolitik könnte nun aber die Basis seines Untergangs sein.
Nachdem Recep Tayyip Erdogan 2003 türkischer Premierminister geworden war, verfolgte er mehrere Jahre lang eine überaus erfolgreiche Wirtschaftspolitik. Den Kern dieser Politik bildeten Reformpläne des Internationalen Währungsfonds, die Schritt für Schritt umgesetzt wurden. Vom Wahlsieg der AKP im Jahr 2002 bis zum Auslaufen des IWF-Reformprogramms acht Jahre später stieg die Wirtschaftsleistung der Türkei um mehr als das Dreifache. Doch wie Rainer Hermann in der FAZ schreibt, begann Erdogan, geblendet vom Erfolg, ab 2010 seine eigenen wirtschafts- und geldpolitischen Vorstellungen umzusetzen – und beförderte sein Land damit in eine Abwärtsspirale, die bis heute anhält.
Erdogan hebelte die Unabhängigkeit der Zentralbank und der Bankenaufsicht aus, setzte politische Günstlinge an die Stelle von Experten und verwirklichte statt wirtschaftlich nachhaltiger Strukturreformen zur Steigerung der Produktivität riesige und entsprechend teure öffentliche Bauprojekte. Reich wurden davon einige bevorzugte Bauunternehmen, die von Erdogans Aufträgen profitierten, während die wirtschaftlichen Kennzahlen nach unten gingen – der Anstieg der Arbeitslosigkeit unter Türken zwischen 15 und 24 Jahren verdoppelte sich etwa seit 2012 auf mehr als 25 Prozent.
Und parallel zum von ihm forcierten Umbau des politischen Systems von einer parlamentarischen Demokratie zu einem Präsidialsystem konzentrierte Erdogan noch mehr Macht in seinen Händen, während sein Beraterkreis immer kleiner wurde und sich der Präsident praktisch nur mehr mit Jasagern umgab. Erdogans Beharren darauf, trotz einer galoppierenden Inflationsrate von beinahe 50 Prozent den Leitzins nicht zu erhöhen, erweist sich unter diesen Gegebenheiten als der Nagel zum Sarg der türkischen Wirtschaft und Währung.
Ob Erdogan mit seiner Politik den Unternehmen mittels niedriger Zinsen billige Kreditfinanzierungen verschaffen, seine religiös bestimmten Vorstellungen eines islamischen Wirtschaftens umsetzen will oder aber sich von der Überzeugung leiten lässt, dass ein Land wie die Türkei im Vergleich zu reichen Industriestaaten auf eine unkonventionelle Wirtschaftspolitik setzen müsse, lässt Hermann dahingestellt. Faktum sei aber einerseits, dass die Rechnung, mit billigem Geld großes Wachstum anzustoßen, nicht aufgehe, und sich die Märkte andererseits einfach nicht so verhielten, wie es Erdogan lieb wäre.
Der Wirksamkeit der vom IWF einst vorgeschlagenen Wirtschaftspolitik hätten Erdogan und die AKP lange Zeit ihre Wahlerfolge zu verdanken gehabt, so Hermann. Die obsessiv verfolgte Niedrigzinspolitik des Präsidenten könnte sich jetzt als die Wurzel seines politischen Niedergangs erweisen.