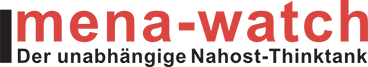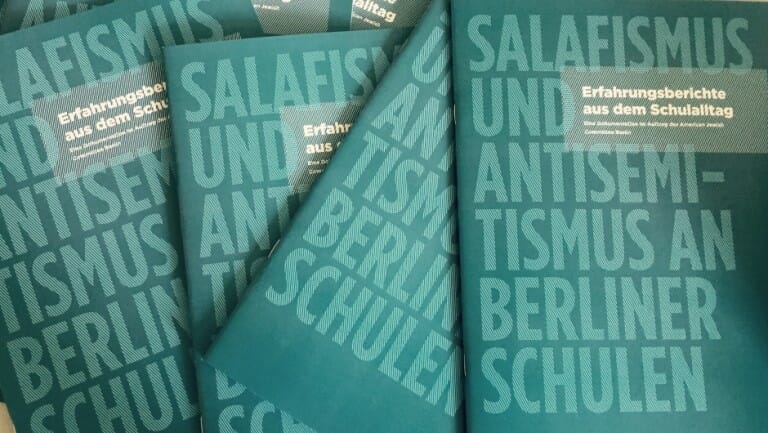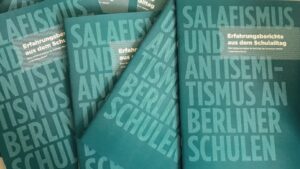
Fast zwei Drittel der Lehrer berichteten, die Bedeutung von Religion habe in den letzten Jahren zugenommen. Der Islam diene der Identifikation und Abgrenzung. Das kollidiere mehr und mehr mit dem Schulalltag. So würden zunehmend gemischtgeschlechtlicher Sportunterricht, Sexualkunde und Evolutionslehre abgelehnt. Minderheiten machten Druck auf andere Schüler. Schulstoff werde von Koranlehrern oder Moscheen überprüft. Ein Lehrer sagt: ‚Wir haben mittlerweile so eine Art Parallelbildung.‘ In Klassen gibt es Moralwächter, die Schüler maßregeln und Aussagen der Lehrer überprüfen. Sie übten Druck aus, zu fasten und ein Kopftuch zu tragen, und verbreiteten ein intolerantes Religionsbild.
Ein Drittel der Lehrer berichte von ausgeprägten Konflikten zwischen den Religionsvorstellungen mancher Schüler und den Werten der demokratischen Grundordnung. Geschlechtergleichheit würde von diesen Schülern abgelehnt. Sie hielten religiöse Texte für wichtiger als die Demokratie und äußerten sich abfällig über Homosexuelle, Atheisten und Juden.
Verschwörungstheorien seien mittlerweile in allen Schülergruppen weit verbreitet, spielten aber für muslimische Schüler eine besondere Rolle und kreisen oft um den 11. September. ‚Die Amerikaner haben natürlich das World Trade Center selber in die Luft gesprengt‘, sagen Schüler, ‚in den Flugzeugen war doch keiner drin‘, ‚jüdische Kreise haben das inszeniert, um die arabische Welt zu diffamieren‘. Die Lehrer sind der Ansicht, dass das Gefühl der eigenen Opferrolle die Schüler anfällig für extremistische Ideologien macht. Terrorismus und Gewalt würden relativiert und als Notwehr betrachtet.“ (Julia Haak: „‚Scheiß-Jude‘. Die Angst vor der Intifada im Klassenraum“)