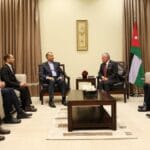Am 15. September 2020 unterzeichneten Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain in einer Zeremonie in Washington Friedensverträge, später kamen Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen Israels zum Sudan und zu Marokko hinzu. Diese Vereinbarungen folgten bereits bestehenden israelischen Friedensverträgen mit Ägypten und Jordanien. Was bedeuten diese Veränderungen für Israel und die Region des Nahen Ostens? Worin bestehen Chancen und Risiken – und wie reagiert die deutsche Außenpolitik?
Teil 1 einer zweiteiligen Serie von Jörg Rensmann
Grundlegung eines neuen Bündnisses
Ein Meilenstein auf dem Wege zu den Verträgen erfolgte laut dem damaligen amerikanischen Außenminister Mike Pompeo auf der Warschauer Konferenz zum Nahen und Mittleren Osten im Februar 2019, auf der Deutschland nur durch einen Staatssekretär – nicht aber durch seinen Außenminister – vertreten war.
Die Konferenz wurde von Polen und den Vereinigten Staaten am 13. und 14. Februar 2019 ausgerichtet. Laut der gemeinsamen offiziellen Ankündigung stand widmete sich das Treffen den Themen „Terrorismus und Extremismus, Raketenentwicklung und -verbreitung, Seehandel und Sicherheit sowie Bedrohungen durch Stellvertretergruppen in der gesamten Region“. US-Außenminister Pompeo zufolge habe der Zweck der Konferenz darin bestanden, sich auf „den Einfluss des Iran und den Terrorismus in der Region“ zu konzentrieren. Das Ziel, dem die Europäer betont verhalten begegneten, war also, eine Allianz gegen das iranische Regime zu schmieden.
Die Entstehung eines arabisch-israelischen Bündnisses gegen den Iran hatte sich spätestens seit 2017 abgezeichnet, als sich die Beziehungen zwischen Israel und den Golfstaaten erwärmt hatten. Mit der Warschauer Konferenz im Februar 2019 erhielten diese Bemühungen zusätzlichen Auftrieb.
Im Zentrum der Annäherung standen gemeinsame Interessen Israels und arabischer Golfstaaten: Wie sollte der iranischen globalen und atomaren Bedrohung begegnet werden, die sich als regionaler Anspruch auf Hegemonie auch gegen sunnitisch-arabische Herrschaftshäuser richtet?
Vordergründige Ziele
Eine Antwort auf diese Frage erschien umso dringlicher, als ein politischer Rückzug der USA aus der Region des Nahen Ostens schon unter US-Präsident Barack Obama begonnen hatte, der das Hauptaugenmerk der US-Außenpolitik auf den asiatischen Raum und die aufstrebende Großmacht China verschieben wollte. Das mit den iranischen Machthabern unter Federführung von Obama verhandelte Atomabkommen JCPOA, das den Griff zur Bombe höchstens verzögert, aber mitnichten grundsätzlich verhindert, ist auch vor diesem Hintergrund zu sehen.
Unter diesen Umständen war aus Sicht der Golfstaaten die Schaffung eines regionalen Bündnisses gegen die iranische Bedrohung, welches das militärisch starke Israel einschließt, geradezu eine aus Vernunft gespeiste Notwendigkeit. Saudi-Arabien ist zwar formal kein Teil der Abraham Accords, doch ohne saudisches Placet hätte es deren Zustandekommen sicher nicht gegeben.
Teil des Abkommens, so hatte es der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz angedeutet, wird es sein, qualitativ hochwertige amerikanische Waffensysteme etwa an die Vereinigten Arabischen Emirate zu liefern, die allerdings die qualitative militärische Überlegenheit der Israelis in der Region nicht infrage stellen dürfen. Die Golfstaaten haben in den vergangenen Jahren bereits beträchtliche Summen in die Aufrüstung ihrer Streitkräfte investiert, nicht zuletzt, um mögliche iranische militärische Angriffe zu verhindern.
Bestandteil des Abkommen ist darüber hinaus die Zusammenarbeit israelischer und emiratischer Think-Tanks, etwa wenn es um eine gemeinsame Analyse der Hegemonialansprüche der Türkei in der Region geht.
Strategische Entscheidung
Die Friedensvereinbarungen haben allerdings auch tiefer liegende Ursachen, die in einer rein funktional-militärischen Kooperation nicht aufgehen, und Auswirkungen, die über die Golfstaaten hinausgehen, wie der amerikanische Nahostexperten David Makovsky vom Washington Institute for Near East Policy betont: Mit den Abraham Accords haben einige arabische Staaten die strategische Entscheidung getroffen, sich von der arabischen Friedensinitiative von 2002 und dem Grundsatz zu verabschieden, normalisierte Beziehungen zu Israel so lange zu verschieben, bis der – in Wahrheit immer schon vergleichsweise unbedeutende – palästinensisch-israelische Konflikt gelöst wäre.
Zu den Friedensbedingungen der arabischen Initiative hatte bekanntlich ein Rückzug Israels auf die (nicht zu verteidigende) Grüne Linie gehört, die Waffenstillstandslinie vor dem Sechstagekrieg 1967. Und sie hatte keine definitive Absage an das von der palästinensischen politischen Führung bis heute behauptete sogenannte „Recht auf Rückkehr“ von inzwischen 5,7 Millionen palästinensischen Flüchtlingen und ihren Nachkommen aus den Kriegen gegen Israel ins Kernland Israel enthalten. Vielmehr hatte sich die arabische Friedensinitiative explizit gegen die dauerhafte Integration der palästinensischen Flüchtlinge in die arabischen Staaten ausgesprochen – das war der Hauptgrund dafür, dass Israel diesem Plan seinerzeit eine Absage erteilte.
Die Abraham Accords haben deutlich hervorgestrichen, was es mit der immer wieder suggerierten Zentralität des palästinensisch-israelischen Konfliktes für die gesamte Region und für einen umfassenden Frieden zwischen Israelis und Arabern auf sich hat: nichts.
Das bedeutet freilich nicht, dass eine Beendigung dieses Konflikts unter den jetzt veränderten Bedingungen nicht mehr wünschenswert wäre. Der emiratische Botschafter in den USA hat kürzlich erneut darauf hingewiesen, dass die Abkommen eine einseitige israelische Annektierung von Palästinensern zugedachten Gebieten der Westbank verhindert hätten und somit durchaus auch im Interesse der palästinensischen Bevölkerung waren.
Auch wenn ein palästinensisch-israelischer Frieden momentan nicht erreichbar erscheint, schlägt Makovsky vor, die Abraham-Abkommen als Ausgangspunkt für kleinere Teilschritte zu sehen, mit denen die Friedensperspektive am Leben gehalten werden könnte. Ein Prozess, der von Saudi-Arabien unterstützt werden könnte, indem es weitere Schritte in Richtung einer vollen Normalisierung der Beziehungen zu Israel unternimmt, beispielsweise durch die Eröffnung von Tourismus- und Investitionsbüros in Israel.
Ende eines Paradigmas
Die Abraham-Abkommen sind nicht Ursache, sondern Ergebnis eines Paradigmenwechsels. Insbesondere für viele arabische Jugendliche in der Region gilt schon jetzt, was der aus dem Irak stammende und in Berlin lebende Schriftsteller Najem Wali kürzlich so formulierte:
„Der arabisch-israelische Konflikt beschäftigt sie wenig (…). Dass Israel die Ursache allen Übels in ihren Ländern ist, glauben sie nicht mehr. Sie haben die Wahrheit durchschaut.“
Das geht auch aus den Worten eines Jungen in einem palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon hervor, die in der Neuen Zürcher Zeitung wiedergegeben wurden:
„Musa träumt … nicht von einer Rückkehr nach Palästina, dem Land seiner Vorfahren. ‚Ihr habt gekämpft und nichts erreicht‘, muss sich sein Vater immer wieder anhören. Musa denkt pragmatisch, er möchte die libanesische Staatsbürgerschaft. ‚Alle meine Freunde wollen sie.‘ Ob er damit eine gute Stelle bekäme, wäre jedoch immer noch fraglich.“
Ein Teil der arabischen Welt hat gezeigt, dass er sich vom palästinensisch-israelischen Konflikt nicht länger die Zukunft diktieren lassen will. Damit einher geht ein Prozess, der sich als entscheidend für die längerfristigen Perspektiven in der Region erweisen könnte: die Veränderung der Rolle der Religion sowie der Wahrnehmung von Juden und des Staates Israel.
Dieser Wandel sollte nicht unterschätzt werden. Aus den Emiraten kommt die Forderung von Farid El-Bayadi, einem wichtigen emiratischen Politiker, in arabischen Schulcurricula die Religion von der Vermittlung anderer Lehrinhalte wie Geographie, Arabisch oder Geschichte zu trennen, d.h. in diesen Fächern die Vermittlung religiöser Inhalte zu unterlassen. Es geht hier perspektivisch um die Forderung nach Trennung von wissenschaftlicher Bildung und Religion.
Und Ali Al Nuaimi, Vorsitzender mehrerer wichtiger Ausschüsse im emiratischen Föderativen Nationalrat, fordert ergänzend die Vermittlung der Geschichte der Shoah als Teil der arabischen Schulcurricula. Sie sei in der Vergangenheit „im gesamten Nahen Osten entweder heruntergespielt oder sogar geleugnet [worden], und angesichts des weltweit zunehmenden Antisemitismus ist es nun an der Zeit, diese bittere Wahrheit anzusprechen.“ Die arabische Welt müsse aus dem Gedenken an die Shoah lernen und dürfe bei der Ermordung von Kurden und Yeziden nicht tatenlos zusehen.
Heute, so kann man an Al Nuaimi anschließen, würde es darum gehen, die Rolle von Muslimen während der Shoah zu vermitteln, wahrheitsgemäß in ihrer Doppelgesichtigkeit: als Judenretter in Nordafrika, wie auch als Täter beim Massenmord an der Seite Nazi-Deutschlands. Und es wäre auch ein Fokus zu richten auf diejenigen arabischen Menschen, die in den vierziger und fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts ihre jüdischen Nachbarn vor Pogromen gerettet haben, so etwa in Ägypten oder Libyen.
Auf der Tagesordnung steht heute zunehmend die Erinnerung an eine gemeinsame judeo-arabische Kultur. Saudi-Arabien hat bereits ein verändertes Schulcurriculum vorgelegt, die Vereinigten Arabischen Emirate ebenfalls, Ägypten ist dabei, Judaismus im Schulunterricht einzuführen und damit vor allem an junge Generationen zu vermitteln, Marokko entsinnt sich schon länger des gemeinsamen judeo-arabischen Erbes und fördert die Antisemitismus-Bekämpfung im eigenen Land.
Juden werden nicht mehr ausschließlich als Störfall in der Region wahrgenommen, es geht um die wahrheitsgemäße Vermittlung jahrhundertealter Geschichte von Juden unter arabischer Herrschaft, in letzter Instanz um die unzweifelhafte Anerkennung historischer und gegenwärtiger jüdischer Präsenz in der Region.
Dazu wird es allerdings nicht ausreichen, das Judentum als Religion zu honorieren, wenn das nicht auch einschließt, das Judentum als Nation mit entsprechenden Konsequenzen anzuerkennen: Judentum ist Religion und Nation zugleich. Wichtig wird sein, das Recht der Juden nicht länger infrage zu stellen, politische Souveränität auszuüben, d.h., sich im jüdischen Staat Israel selbst zu bestimmen.
Es gibt viele gute Zeichen, auch wenn die Entwicklung selbstverständlich noch einige Fallstricke birgt. Aber es wäre eine besondere Ironie der Geschichte, wenn der gegen die Existenz des Staates Israel gerichtete Antizionismus in der arabischen Welt nach und nach an Anziehungskraft verlöre, während er bekanntlich in Europa als israelbezogener Antisemitismus gefährlich hohe Zustimmungswerte aufweist.
(Jörg Rensmann ist der Programmdirektor des Mideast Freedom Forum Berlin. Der zweite Teil der Serie ist hier zu finden.)